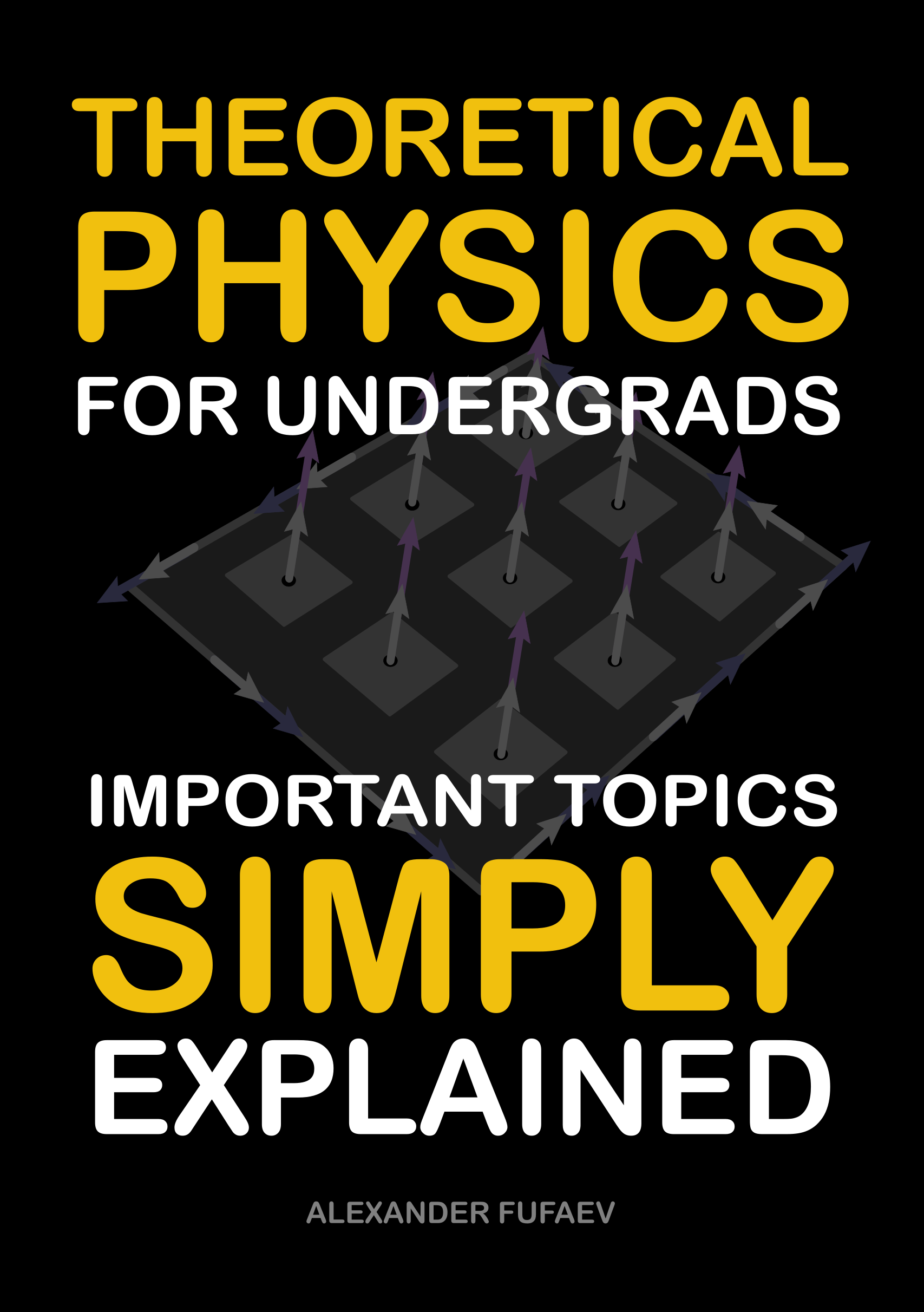Jugendabenteuer in Asow, Russland. Mobbing. Baumhaus. Goldenes Pferd und die Beschwörung der Pik-Dame. Scheidung meiner Eltern.
2002 bis 2004. Als ich in die vierte Klasse wechselte, kauften meine Eltern mit der finanziellen Unterstützung meiner Großeltern eine sehr günstige Drei-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss eines vierstöckigen Hauses am Petrovsky Boulevard in Asow. Nach einer Renovierung mit großer Hilfe von Opa Yura, der öfter mal vor sich hin geschimpft hatte, weil die Tapeten nicht das taten, was er verlangte, zogen wir ein. Die Wohnung war ein Schnäppchen, weil sich dort ein alter Mann im Abstellraum erhängt hatte und Interessenten normalerweise davon abgeschreckt waren. Meine Eltern nahmen das in Kauf; dafür hatten wir unsere eigene Dreizimmerwohnung. Nachdem mir Dima von dem Vorfall mit dem erhängten Mann erzählt hatte, bekam ich immer Gänsehaut am ganzen Körper, wenn ich alleine in der Wohnung war und die quietschende Tür des Abstellraums öffnete.
Wenn man vor dem Abstellraum stand, konnte man sowohl nach links als auch nach rechts in eines der Zimmer fliehen, falls der Geist des alten Mannes tatsächlich erscheinen sollte.
Bog man nach links ab, dann stand man in Maschas und meinem Zimmer, mit zwei Betten und einer kleinen Spielecke für Mascha. Aus dem Fenster dieses Zimmers, das auf der Hofseite lag, konnte ich sofort sehen, ob meine Freunde aus der Nachbarschaft auf dem Hof abhingen. Das waren einmal mein bester Freund Sanja aus dem Hochhaus direkt nebenan und Rafik, der mit seiner Mutter und Schwester neben uns im Erdgeschoss wohnte. Außerdem die einige Jahre ältere Jana mit ihrer Schwester Vika aus dem dritten Stock über uns und Igor, der einige Häuser weiter weg wohnte, aber trotzdem immer bei uns auf dem Hof abhing. Aber auch meine anderen Freunde, die ich am Petrovsky Boulevard kennenlernte.
Bog man nach rechts ab, gelangte man ins Schlafzimmer der Eltern, das auf der Straßenseite lag. Durch das Fenster sah man eine zweispurige Straße, hinter der sich, etwas weiter rechts, ein großer Basar erstreckte. Dort verkauften die Menschen von morgens bis abends frisches Gemüse, Obst, Fisch, Eier und vor allem unterschiedlichste Süßigkeiten. Auch russische Großmütter, Babuschkas, saßen auf Hockern und verkauften in Öl gebratene, ungeschälte Sonnenblumenkerne, die bei den Russen sehr beliebt waren. Die Beliebtheit der Sonnenblumenkerne lag aber zum größten Teil nicht am Geschmack der Kerne, sondern an dem geschickten Knacken der Schale mit den Zähnen. Neben den Babuschkas saß – in einer kleinen Hütte, die mich an das Haus mit Hühnerbeinen von Baba Jaga erinnerte – ein Bäcker, der stets ein Grinsen auf den Lippen trug, während er frisches Brot verkaufte.
Meine Mama schickte mich am Wochenende immer zu ihm, um für ein paar Rubel Weiß- oder Borodinski-Brot zu kaufen. Auf dem Weg zurück vom Bäcker konnte ich kaum der Versuchung widerstehen, in den knusprigen Rand des duftenden, warmen Brotes zu beißen.
Sobald ich wieder die Wohnung betrat, konnte ich das das vertraute Klappern eines Löffels in einer Tasse hören. Das war Dima, der nach seiner Art den Kaffee für sich und Mama zubereitete. Dazu gab er Zucker und Kaffeepulver mit einem Teelöffel Wasser in eine Tasse. Danach rührte er das Gemisch mit einem Teelöffel so lange um, bis alles gut vermischt und hellbraun war. Nachdem ich das süß schmeckende Gemisch mit einem Finger probiert hatte, goss Dima es auf. Während das heiße Wasser Dimas Mischung in einen trinkbaren Kaffee verwandelte, breitete sich in der ganzen Wohnung der Duft nach Kaffee aus. Vielleicht schaffte es der Geruch sogar durch die offenen Fenster nach draußen, wo die Babuschkas bereits an ihrem Stammtisch tratschten und meine Freunde an der Klimmzugstange herumalberten.
Das Brot brachte ich direkt ins Wohnzimmer, das wie mein Zimmer, ebenfalls auf der Hofseite lag. Dort stand ein alter, aufklappbarer Tisch, der bereits gedeckt war. Zwei Tassen Kaffee für Mama und Dima, zwei Tassen schwarzen Tee für mich und Mascha. Vier weichgekochte Eier und dazu für jeden von uns jeweils ein gekochtes Milchwürstchen sowie das Brot, das Mama in dicke Scheiben schnitt. Wir frühstückten im Wohnzimmer, weil die Küche sehr klein war und dort höchstens zwei Menschen sitzen konnten, ohne dabei aneinander gequetscht zu sein.
Unter der Woche waren Dima und Mama zur Frühstückszeit bereits auf der Arbeit. Mama hatte einen neuen Job als Dozentin an einem Polytechnikum einige Straßen weiter. Jeden Morgen bereitete sie mir ein in Folie gepacktes Butterbrot und eine kleine Flasche Mineralwasser vor, die ich mit zur Schule nehmen konnte. Da meine bisherige Schule nur bis zur dritten Klasse ging und weit von unserer Wohnung entfernt lag, war ich für die vierte Klasse erneut in eine andere Schule gewechselt.
![]()
Mein neuer Schulweg führte eine sehr lange Allee entlang. Unterwegs gab es einen Kiosk, bei dem ich Kaugummis mit Aufklebern, Chupa Chups oder andere Süßigkeiten kaufte. Manchmal gönnte ich mir auch eine Packung Marlboro, die ich allerdings gut vor meiner Mutter und Schnorrern verstecken musste. Die Zigaretten rauchte ich mit Igor, Rafik oder Anton hinter dem Kiosk, in einem kleinen Waldstück mit Tannenbäumen. Es war eklig dort. Überall auf dem Boden lagen Müll, benutzte Kondome und tausende Kippen herum. Doch immerhin mussten wir uns, abgesehen von irgendwelchen Junkies, keine Sorgen machen, von irgendwem erwischt zu werden.
![]()
Nachdem ich den Kiosk hinter mir gelassen hatte, stand auf der Hälfte des Weges eine schwarze Hirsch-Statue vor einem großen Hügel. Im Winter rasten wir Kinder dort oft mit dem Schlitten oder einem Karton herunter. Rechts neben dem Weg fuhren Autos und hinter der Straße erstreckte sich ein riesiger Park. Dort gab es verschiedene Attraktionen, unter anderem ein Riesenrad, das über alle Häuser und Bäume hinausragte. Im Winter stand es wie eingefroren still, aber im Sommer konnte man von Weitem beobachten, wie es sich langsam drehte. Von ganz oben konnte man sogar unser altes Hochhaus sehen.
Am Ende der Allee kam schließlich meine rot-weiß gestrichene Schule zum Vorschein. Hinter den wuchtigen Türen erwartete mich eine weitläufige Halle mit vielen herumalbernden Schülern, lautes Geschrei und eine große Garderobe am Eingang. Treppen an den Seiten führten zu den oberen Stockwerken. Dort erstreckten sich lange Gänge, in denen ich mit anderen Schülern während der Pause Fangspiele spielte.
![]()
In dieser Schule traf ich zum ersten Mal ältere Jugendliche aus höheren Klassen, die mir und anderen, schwächeren Schülern Ärger bereiteten. Sie machten sich über meinen Nachnamen lustig oder über meine beiden Muttermale im Gesicht – eines rechts neben der Lippe und eines mitten auf der linken Wange. Auch mit meinen etwas größeren Ohren hatten die Typen ein Problem, weshalb ich meine Haare immer länger trug, um sie zu kaschieren. Wenn ich mich mit Fäusten wehrte, erlebte ich selbst ein blaues Wunder. Schlägereien und die damit einhergehenden angeschwollenen Augen waren an der Tagesordnung. Ein falscher Blick, ein falsches Wort – und schon lungerten diese Gopniki irgendwo vor dem Schulgelände herum, um mich zu erwischen. Sobald ich sie sah, nahm ich einen anderen Weg nach Hause. Manchmal erwischten sie mich dennoch. Dann nahmen sie mir entweder mein Geld ab oder schubsten mich herum. Begegnete ich ihnen allein, gab es genau zwei Möglichkeiten, ihnen zu entkommen: Entweder die paar Rubel aus meiner Tasche herauszurücken oder die Beine in die Hand zu nehmen und so schnell wie möglich wegzurennen. Die zweite Option hatte den Nachteil, dass eine weitere Begegnung mit diesen Jugendlichen meist schlimmer ausfiel. Am sichersten war es, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs war – insbesondere abends.
Es war wichtig, sich in Anwesenheit dieser draufgängerischen Jugendlichen selbstbewusst zu verhalten, immer schön cool zu gehen und das Kinn oben zu halten, um nicht als Opfer wahrgenommen zu werden. Wer diese Regel nicht befolgte, galt als Opfer und wurde dementsprechend behandelt. Es war auch nicht unbedingt ratsam, ein Musterschüler zu sein, da gute Noten ebenfalls nur Ärger brachten.
Manchmal zwangen mich diese Gopniki auch dazu, andere zu provozieren. Zum Beispiel, den durch die Gänge laufenden Schülern ein Bein zu stellen, damit sie auf den harten Kachelboden knallten, und damit eine Schlägerei auszulösen. Irgendwann gewöhnte ich mir das Mobben an und ärgerte immer einen ein paar Jahre jüngeren Jungen namens Dima, der im gleichen Hochhaus wohnte wie ich. Ich gab ihm Ohrfeigen, nahm ihm seine Pokémon-Karten weg oder zwang ihn, etwas für mich zu erledigen. Dann lief er heulend nach Hause und erzählte seiner Mutter davon. Während ich mich unter einem Baum versteckte, beobachtete ich, wie seine Mutter auf den Balkon kam und mit geballter Faust so laut schrie, dass bestimmt jeder am Hof sie verstehen konnte:
»Sascha, du Mistkerl! Ich weiß, dass du dich da unten versteckst! Hör sofort auf, Dima zum Heulen zu bringen!«
Manchmal klingelte seine Mutter auch an unserer Wohnungstür, um mit meinen Eltern zu sprechen. Deshalb hatte ich immer ein bisschen Schiss, wenn ich Dima ärgerte und er mich dann bei seiner Mutter verpetzte. Ich haute dann ab, möglichst weit weg vom Hof, weil mein Vater mir sonst dafür im wahrsten Sinne des Wortes die Ohren langgezogen hätte. Deshalb hörte ich irgendwann auf, den kleinen Dima zu ärgern. Außerdem war ich mittlerweile mit einer anderen Sache beschäftigt, denn zu meinem Geburtstag bekam ich von Opa Yura, Oma Lina und Onkel Sascha mein erstes Fahrrad, das ich mir auf dem Asowschen Basar selbst aussuchen durfte. Ich entschied mich für ein schwarzes Fahrrad mit kleinen Rädern, die orangefarbene Streifen an den Seiten hatten. Weil es mein allererstes Fahrrad war, musste ich zuerst das Fahren lernen. Deshalb übte ich in den Ferien bei meinen Großeltern im Dorf, das Gleichgewicht auf dem weichen Gras zu halten. Ksjuscha half, mich anzuschubsen. Als ich das Fahrradfahren nach vielen Stürzen einigermaßen beherrschte, stand mir nichts mehr im Weg, meine Skills auch in der Stadt auszuprobieren. So konnte ich an den bösen Jungs einfach vorbeirasen, bevor ihre kleinen Gehirne mich zu registrieren anfingen.
Mit dem neuen Fahrrad war es im Sommer viel einfacher, die Stadt nach Holzbrettern, leeren Kartons und Ziegelsteinen für unser Baumhaus abzusuchen, das wir im Hof bauen wollten. Während ich mit meinen Freunden Sanja, Rafik und Igor durch die Gegend streifte, hielt ich jedoch nicht nur nach Rohstoffen Ausschau, sondern auch nach auf dem Boden herumliegenden, nicht bis zum Ende gerauchten Kippen. Manchmal fand ich eine, hob sie auf, betrachtete sie kurz und roch an ihr, um sicherzugehen, dass sie nicht angeschissen worden war. Dann steckte ich mir die Kippe zwischen die Lippen und machte sie mit dem letzten Streichholz an, das ich an der Seite meiner Schuhsohle anzündete, die mit einer Reibfläche ausgestattet war.
»Schaut mal! Da ist irgendein Typ unter dem Tannenbaum«, sagte Igor zu uns. Wir gingen näher an den Baum heran, um zu checken, wer das war und was er dort anstellte. Es war ein Gopnik, der an einer Plastiktüte schnüffelte. Igor hob einen Tannenzapfen auf und warf ihn auf den Rücken des Gopniks. Dieser drehte den Kopf und sah sich suchend um, bis er realisierte, dass er entdeckt worden war.
»Verschwindet, Pidarasy blyat«, lallte er kurz und schnüffelte weiter an seiner Plastiktüte. Ich hob auch einen Tannenzapfen vom Boden auf und traf damit sein Bein.
»Suka, na wartet, pisdez wam«, brüllte der Gopnik wütend, kam aus den Ästen des Tannenbaums hervor und ging schnell auf uns zu. Wir rannten weg. Blöderweise liefen wir alle in unterschiedliche Richtungen. Ich hielt bei einem noch nicht bis zum Ende gebauten, kleinen Kiosk an.
»Pass auf!«, hörte ich plötzlich Sanja schreien, während ich kurz hinter die Ecke des Kiosks blickte. Ich hatte mich gerade umgedreht als der Gopnik mich entdeckte, am T-Shirt packte und um die Ecke zerrte. Er drückte mich mit einer Hand an die Wand und griff mit der anderen hinter seinen Rücken. In dem Moment ging ich davon aus, dass er nach seinem Messer greifen und mich abstechen wollte.
»Pamagiiiiiite!«, schrie ich so laut wie möglich nach Hilfe. Mein lauter Schrei machte die älteren Nachbarjungs, die in Sichtweite auf einer Bank chillten, aufmerksam.
»Ey, du!«, rief einer von ihnen in unsere Richtung und alle Jungs liefen auf uns zu. Während der Gopnik kurz in ihre Richtung blickte, lockerte sich sein Griff und ich nutzte die Chance, um mich aus seiner Hand loszureißen und mich hinter dem unfertigen Kiosk zu verstecken. Von dort aus beobachtete ich dann, wie der Gopnik sich bücken musste und jeder der fünf oder sechs Jungs ihm einen Arschtritt verpasste. In dem Moment war ich unglaublich erleichtert, dass ich unversehrt aus dieser brenzligen Situation gekommen war. Was wäre mir zugestoßen, wenn die Jungs nicht in der Nähe gewesen wären? Dann wäre ich im Krankenhaus gelandet oder im schlimmsten Fall sogar tot. Für diesen Tag war unsere Suche nach Baumaterialien jedenfalls beendet.
Einige Tage später nahmen wir unseren Plan allerdings wieder auf. Nach der Schule überlegten wir gemeinsam, wie wir zunächst den Boden des Baumhauses bauen könnten. Eine dicke Platte oder überhaupt Holzbretter dafür zu finden, war gar nicht einfach. Wir durchsuchten beinahe die ganze Stadt und fanden nichts Geeignetes. Die einzige Möglichkeit, die uns noch einfiel, bestand darin, Bretter von irgendeiner Baustelle zu entwenden.
Nicht weit von unserem Hof, hinter einem kleinen Waldstück, wurde tatsächlich irgendein Gebäude gebaut. Die Baustelle war mit einer anderthalb Meter hohen, weißen Mauer umzäunt. Als ich mit Rafik, Igor und Sanja eines Abends über die Mauer kletterte, war das zu bauende Gebäude einige Dutzend Meter von uns entfernt. Die Baustelle schien menschenverlassen zu sein. Keine Bauarbeiter waren zu sehen. Trotzdem liefen wir vorsichtig in gebückter Stellung zu einem großen Ziegelsteinhaufen einige Schritte von uns entfernt und versteckten uns dahinter. Von hier aus hielten wir Ausschau nach etwas, das uns als Boden für das Baumhaus dienen könnte. Nach kurzer Zeit entdeckten wir etwas, wonach wir zwar nicht gesucht hatten, das aber trotzdem als Boden für das Baumhaus dienen könnte. Gestapelte Holzpaletten.
»Wie viele davon brauchen wir?«, fragte uns Igor.
»Drei, vier würden reichen«, antwortete er. Nach kurzem Umschauen schlichen wir zu dem Holzstapel. Jeder von uns hob eine Holzpalette auf. Sofort machten wir uns auf den Rückweg. Sanja kletterte als erster über die Mauer. Dann machte Rafik es ihm nach. Igor schob den beiden auf der anderen Mauerseite vorsichtig seine Holzpalette von oben zu.
»Nicht so laut«, flüsterte ich meinen Freunden zu, weil die Holzpalette beim Rüberschieben Geräusche verursachte. Als dann Igor über die Mauer zu klettern begann, hörte ich eine murmelnde Stimme. Ich drehte mich um, um zu sehen woher das Geräusch kam. Ein Mann streifte ungefähr fünfzehn Meter von uns entfernt durch die Baustelle und redete wohl mit sich selbst.
»Scheiße, wir werden gleich entdeckt«, flüsterte ich Igor zu, der bereits auf der Mauer saß.
»Ey, was macht ihr da?«, schrie der Mann in unsere Richtung und bewegte sich auf uns zu. Ohne zu zögern warf ich voller Adrenalin meine schwere Holzpalette über die Wand. Ich blickte kurz zurück, um zu sehen, wo der Mann war. Er war nur noch fünf oder sechs Meter von mir entfernt, in seinen Händen vermutlich ein Gewehr. Mit einem kleinen Anlauf sprang ich auf die Mauer und war zur Hälfte hinübergeklettert, als mir der Mann mit seinem Gewehr mit voller Wucht auf das Bein schlug. Er packte mich gerade noch so am Fuß und zog dabei meinen Latschen aus. Ich war glücklicherweise bereits auf der anderen Seite der Mauer. Ohne meine Holzplatte aufzuheben, hinkte ich mit schmerzendem Bein und nur einem Schuh meinen Freunden nach. Der Mann schien uns nicht mehr zu folgen.Ich setzte mich im Waldstück kurz auf einen Baumstamm und schaute mir mein Bein an. Es tat weh, aber ich konnte keine sichtbare Verletzung erkennen. Meine Freunde kamen aus ihren Verstecken.
»Wartet mal kurz hier, ich hole die andere Palette«, sagte Igor und schlich zur Mauer. Nach einigen Minuten kehrte er mit unserer Beute zurück. Und die war das schmerzende Bein und den verlorenen Latschen allemal wert gewesen.
In den nächsten Tagen nagelten wir die Paletten an den Baum und bedeckten sie mit Kartons. So entstand die Grundlage unseres Baumhauses. Nach der Schule durchsuchten wir die Stadt weiter nach Baumaterialien. Einige Pappkartons für die Seitenwände des Baumhauses fanden wir auf den Müllhalden.
»Jungs, schaut mal«, sagte Sanja zu uns und zeigte auf einen Karton. »Da ist etwas drin!«
Wir bückten uns zum Karton hin und öffneten ihn. Er war gefüllt mit verpackter, ungeöffneter Schokolade. Mit Pralinen verschiedenster Sorten.
»Das ist ja der Wahnsinn! Lasst uns das Zeug in unser Baumhaus bringen«, sagte Rafik. Ich hob den recht schweren Karton auf, meine Freunde nahmen die anderen leeren Kartons und gemeinsam brachten wir alles in das noch wandlose, dachfreie Baumhaus. Rafik kletterte auf den Baum und nahm mir den Karton ab. Dann kletterten ich, Sanja und Igor ebenfalls nach.
»Lasst uns mal die Schokolade probieren«, sagte ich eifrig zu den anderen und nahm mir eine mit einer Schleife verpackte Praline aus dem Karton heraus und sah sie kurz an, um sicherzugehen, dass sie nicht verschimmelt war. Dann führte ich sie schnell zum Mund und biss die Hälfte ab.
»Schmeckt super!«, sagte ich kauend. Meine Freunde nahmen sich ebenfalls eine Praline aus dem Karton.
»Ahhh, da sind Würmer drin!«, schrie Rafik auf, nachdem er von der Praline abgebissen hatte. Er warf sie sofort weg. Schnell blickte ich auf das Innere meiner angebissenen Praline und entdeckte mit aufgerissenen Augen das schlenkernde Ende einer kleinen weißen Made. Wenn ich etwas hätte ausspucken können, dann hätte ich das getan, doch die andere Hälfte war schon längst in meinem Magen verschwunden. Angewidert schleuderten wir alle vier die Pralinen weit weg vom Baum. Rafik brachte den ganzen Schokoladenkarton wieder auf die Müllhalde, während ich mit Sanja und Igor die Wände aus den leeren Kartons baute. Ein paar kleine Nägel und einen Hammer zur Befestigung der Kartons an den Ästen brachte Igor von zu Hause mit.
Nun besaß unser Baumhaus nicht nur einen Boden, sondern auch noch Kartonwände. Ein Dach wollten wir gar nicht bauen, weil es drinnen sonst dunkel gewesen wäre und die Pappe dem Regen eh nicht standgehalten hätte.
Unter dem Baum, der unser Baumhaus beherbergte, stand ein eckiger Tisch mit Bänken, an dem täglich Babuschkas tratschten. Im Baumhaus spielten wir um unsere Pokémon-Spielmarken. Das waren runde Chips aus Plastik oder Papier mit verschiedenen Pokémons auf der einen und einem Pokémon-Ball auf der anderen Seite. Jeder legte seinen Chip mit dem Pokémon-Ball nach oben ab, bis sich ein Stapel gebildet hatte. Dann spielten wir Tsu-Ye-Fa (Schere-Stein-Papier). Manch einer würde behaupten, dass es sich dabei um ein reines Zufallsspiel handelte, doch das war es nicht. Es war ein Psychologiespiel, bei dem es darum ging, die Körpersprache meiner Freunde zu lesen und sie mit meiner eigenen Körpersprache in die Irre zu führen. Igor war darin am besten. Er gewann praktisch jedes Mal Tsu-Ye-Fa. Doch im nächsten Schritt war er aber bei Weitem nicht so gut. Der Gewinner nahm dann den Chipstapel in die Hand und ließ ihn mit selbstgewählter Wucht am Boden abprallen, mit dem Ziel, dass sich möglichst alle Chips umdrehten. Alle Chips, die sich umgedreht hatten, durfte er behalten. Danach war der Verlierer von Tsu-Ye-Fa mit dem Abwerfen des restlichen Stapels dran. Und dann wieder der Gewinner, bis keine Chips mehr übrigblieben.
Wenn wir im Baumhaus nicht gerade Pokémon in spielten, machten wir dort komische Geräusche und versuchten dann das Lachen zu unterdrücken, weil die Babuschkas unter uns deswegen genervt waren. Einmal ließen wir mitten im Sommer einen dicken Böller durch ein Loch im Boden unseres Baumhauses fallen. Direkt neben dem vollbesetzten Tisch. Ein lauter Knall.
»Seid ihr ganz verrückt geworden!«, schrie eine der Babuschkas. Es piepste in meinem Ohr.
»Na wartet, jetzt rufe ich die Polizei!«, schrie sie weiter und ging entschlossen in Richtung des Treppenhauses. Einige Minuten später tauchte ein Polizeiwagen bei uns im Hof auf. Rafik haute nach links ab. Igor nach rechts. Ich in Richtung des Kiosks auf der Allee. Ich rannte hinter das benachbarte Hochhaus in das Tannenbaumgebiet, wo wir immer Zigaretten rauchten. Dort versteckte ich mich gebückt unter den Ästen eines großen Tannenbaums und schaute umher. Nachdem ich eine Weile abgewartet hatte, schlich ich – in der Hoffnung, dass der Polizeiwagen schon weg war – zur Ecke des Hochhauses. Dort sah ich vorsichtig in Richtung unseres Hofs. Der Polizeiwagen war nicht mehr zu sehen. Dafür waren meine Freunde auf dem Hof und spielten wohl Versteckspiele. Ich zögerte nicht und schloss mich ihnen an.
Wenn wir viele Leute waren, spielten wir gerne Fangspiele oder Versteckspiele. Wir verbargen uns in Treppenhäusern, Aufzügen, auf Bäumen und in Durchgängen und warteten darauf, gefunden zu werden. Da der Hof riesig war, dauerte das Suchen stundenlang. Meistens dämmerte es schon und die Lichter in den Fenstern der Wohnungen gingen allmählich an. Nur die Fenster der Treppenhäuser blieben dunkel.
Das Licht funktionierte dort in einigen Hochhäusern nicht. Wenn es dunkel wurde, sah man abends die Haustreppe nur, weil noch das Sonnenlicht oder Mondlicht zusammen mit dem Licht der Straßenlaternen durch die Fenster schien. Im Erdgeschoss, direkt an den Hauseingängen, gab es überhaupt keine Fenster. In diesem Bereich des Gebäudes wurde es in der Nacht stockdunkel. Es war stets ein Nervenkitzel, dort durchzugehen. Gänsehaut breitete sich über dem ganzen Körper aus, sobald man die Schwärze betrat. Niemand traute sich mehr, in dunklen Treppenhäusern zu suchen oder sich dort für eine längere Zeit zu verstecken. Jeder ging dann nach Hause, weil am nächsten Tag Schule war. Oder wir setzten uns kurz auf eine Bank im Hof oder an den mittlerweile leeren Babuschka-Tisch. Dann holten wir unsere Laserpointer von zu Hause und strahlten damit in die Fenster der Hochhäuser, bis irgendein Mann herausguckte. Wir warteten, bis er wieder verschwand, bevor wir das ganze Spiel wiederholten. Irgendwann machte er die Gardinen zu. Dann richteten wir den Strahl in ein anderes Fenster.
Am Wochenende durften meine Freunde und ich bis spät in die Nacht auf dem Hof spielen. Draußen auf der Bank oder am Babuschka-Tisch erzählten wir uns in der Abenddämmerung Geschichten über Tote, Friedhöfe und Geister. Es war so mystisch und kühl, dass ich oft gar nicht wusste, ob ich wegen der Geschichten oder wegen des sommerlichen Abends Gänsehaut bekam.
Jana und Vika erzählten einmal, dass ihre Mutter ein Buch über schwarze Magie besaß. Wir fanden das sehr aufregend.
»Vika, hol mal das Buch«, sagte ihre Schwester zu ihr.
Dann lief Vika kurz nach Hause. Am Eingang ließ sie die Treppentür offen, damit wenigstens ein bisschen Licht in die Dunkelheit des Hauses eindrang. Sie und Jana wohnten im dritten Stock. Während Vika weg war, erzählte Igor irgendeine Geschichte. Ich hörte nur mit halbem Ohr zu, da der dunkle Teppenhauseingang meine Aufmerksamkeit fesselte. Fast erwartete ich, dort etwas zu sehen. Ich wusste nicht, ob Stunden oder nur Minuten vergangen waren, als Vika schließlich nach draußen trat und mich dabei so erschreckte, dass ich zusammenzuckte.
»Da bin ich… wieder«, sagte sie nach Luft schnappend und knallte ein schwarzes Buch auf den Tisch. Rafik zündete mit einem Streichholz eine Zigarette an und leuchtete kurz auf das Buch. Nach einigen Sekunden, als das Feuer das Ende des Streichholzes erreichte, schüttelte Rafik das Feuer aus. Die Sonne war schon untergegangen und man konnte die Schrift nur dank des Lichts der Straßenlaternen in der Nähe erkennen. Wir blätterten langsam die Seiten durch. Die Anleitung zur Beschwörung der Pik-Dame zog uns ganz besonderes in den Bann. Vika erzählte, dass sie das schon ausprobiert hatte, dann erschien angeblich ein Geist im Spiegel und wollte sie erwürgen. Der Legende nach, so erzählte sie, war die Pik-Dame selbst gar nicht böse, sondern die Kreaturen, die zusammen mit ihr durch einen Spiegel in unsere Welt gelangen könnten. Bevor sie etwas Schlimmes tun konnten, sollte man schnellstmöglich die angefertigte Zeichnung auf dem Spiegel wegwischen. Wir fanden das so gruselig, dass wir es unbedingt auch ausprobieren wollten.
In der nächsten Nacht versammelten wir uns zu fünft im dunklen Treppenhaus. Nach dem Anzünden einer Kerze befolgten wir die Anleitung Schritt für Schritt: Rafik hielt den rechteckigen Spiegel, während Vika mit ihrem roten Lippenstift eine vierstufige Treppe malte. Am unteren Ende der Treppe schmierte sie eine Tür und auf die oberste Stufe ein Punkt. Dann hielt Jana eine Pik-Dame-Karte mit der Vorderseite an den Spiegel und wir riefen alle zusammen – bei Kerzenlicht, im Kreis sitzend und auf den Spiegel starrend:
»Píkawaja Dáma pridí« »Pik-Dame erscheine«»Pik-Dame erscheine«
Einer von uns kicherte. Kurzes Schweigen. Dann ging die Beschwörung weiter:
»Píkawaja Dáma pridí«»Pik-Dame erscheine«
»Sanja, da ist jemand hinter dir, auf der Treppe!«, quatschte Rafik dazwischen. Ein kalter Schauer lief über meinen Rücken. Ich schaute mich kurz zur Sicherheit um. Niemand war da.
»Pik-Dame…«, plötzlich erschreckte uns das Quietschen der Treppenhaustür, die sich geöffnet hatte. Eine nicht zu erkennende Person, deren langsamer Gang einem Zombie ähnelte, lallte etwas mit einer tiefen männlichen Stimme vor sich hin. Rafik fiel der Spiegel aus der Hand und zerbrach, während wir kreischend auseinanderstoben.
Das goledene Pferd
An einem anderen Tag erzählte uns Rafik, während wir auf der Bank abhingen, eine Legende von einem goldenen Pferd, das irgendwo unter Asow vergraben sein sollte. Ein zwei Meter hohes Pferd aus purem Gold, das darauf wartete, von uns gefunden zu werden. Ohne zu zögern, machten wir uns auf die Suche nach dem Schatz, der uns steinreich machen würde. Wir besorgten eine Taschenlampe, ein Seil, einen Hammer, eine Schaufel und Proviant und gingen zusammen los, um die ganze Stadt zu durchsuchen.
Alle möglichen Gegenden wurden von uns durchforstet, bis wir auf ein dunkles Loch im Boden in einer verlassenen Gegend stießen. Es war dunkel dort und man konnte den Grund nicht erkennen. Nachdem jemand mit einer Taschenlampe reingeleuchtet hatte, realisierten wir, dass es mindestens zwei Meter tief war und man anscheinend sogar unten weiter hineingehen konnte. Ein Seil hatten wir zwar dabei, doch niemand traute sich, nach unten zu klettern – also musste Tsu-Ye-Fa für uns entscheiden. Ich hatte leider Pech… Meine Freunde warfen das eine Ende des Seils in das Loch hinein, das andere Ende hielten sie fest und drückten mir die Taschenlampe zwischen die Zähne. Ich packte das Seil mit beiden Händen und kletterte nach unten.
Je weiter ich nach unten vordrang, desto schlechter wurde die Luft. Der Gestank war nicht auszuhalten: eine Mischung aus Fäkalien und Alkohol. Ganz unten angekommen, holte ich die Taschenlampe aus der Tasche, richtete sie vor mir aus und drückte, möglichst geräuschlos, auf den Einschaltknopf. Im gelben, gedimmten Licht der Taschenlampe leuchtete die mit Ziegelsteinen bepflasterte Hölle auf. Zwischen Bergen von Müll lagen bewegungslos zwei Penner, die anscheinend dort schliefen.
»Ey! Zieht mich hoch!«, flüsterte ich meinen Freunden zu, während ich nach oben blickte und die ins Loch schauenden Köpfe meiner Freunde sah. Wer weiß, was das für Typen waren… Eins war sicher: Es waren keine Leichen, denn als wir am nächsten Tag nochmal nachsahen, waren sie verschwunden. Deshalb konnten wir diesmal bis ans Ende des Gangs vordringen. Dort befand sich eine Wand, hinter der wir das goldene Pferd vermuteten. Also schlugen wir einige Tage lang mit dem Hammer darauf, um die Wand zu durchbrechen. Wir schafften nur, ein kleines Loch reinzuschlagen, bis die Arbeit und der Geruch uns zu anstrengend wurden und wir das goldene Pferd aufgaben.
Rafik verschwunden
Der Sommer neigte sich seinem Ende zu. Sanja und Igor und meine anderen Freunde fuhren noch mit ihren Eltern in den Urlaub, auch Rafik, der mit seiner Mutter und kleinen Schwester direkt über uns wohnte, war diesen Sommer weg. Doch er kam von diesem Urlaub nie wieder zurück zum Hof.
Seine Mutter erzählte meiner Mutter mit zitternder Stimme, dass er laut der Ermittlungsbehörde von einem starken Sog im Asowschen Meer in die Tiefe gezogen wurde, während sie nichtsahnend am Strand saß. Trotz einer verzweifelten Suche mit dem Hubschrauber kam jede Hilfe zu spät.
Von da an lastete wochenlang eine traurig-düstere Atmosphäre über dem Hof, und es war seltsam, meinen einst lebhaften Freund Rafik nie mehr dort zu sehen. Ein unheimliches Gefühl durchströmte mich jedes Mal, wenn ich im Treppenhaus an Rafiks Wohnungstür vorbeiging und für einen Moment innehielt, um an ihn zu denken. Es fühlte sich an, als ob etwas Unerklärliches in seiner Wohnung lauerte und mich direkt durch den Türspion beobachtete.
![]() Hochhaus, in das meine Großeltern gezogen sind.
Hochhaus, in das meine Großeltern gezogen sind.
Galja und Gogi zogen dauerhaft von Usbekistan nach Asow um. Sie hatten ihr Haus in Usbekistan verkauft. Das Geld aus dem Verkauf reichte aus, um am Krasnoarmeyskiy Pereulok, einige Straßen weiter von unserer Wohnung entfernt, eine Einzimmerwohnung im ersten Stock zu kaufen. Bis auf die Matratzen zum Schlafen war die Wohnung zuerst komplett leer. Die Küche und der Balkon sahen am heruntergekommensten aus.
Im Laufe einiger Monate besorgten Galja und Gogi sich zunächst einen neuen Herd, einen Fernseher und andere Haushaltsgeräte in den Technikläden direkt auf dem Basar. Betten gab es erst viel später, weshalb sie vorerst auf dem Boden schliefen. Gogi renovierte die Wohnung mühevoll. Die ganzen neuen Haushaltsgeräte, das schöne Parkett im Wohnzimmer, die Klimaanlage, hochwertige Fliesen im Badezimmer, im Dunkeln leuchtende Lichtschalter und vor allem der renovierte Balkon, der von außen schneeweiß aussah, ließen die Wohnung für meine Verhältnisse sehr luxuriös wirken.
Am Wochenende machte ich mich immer abends, nachdem ich draußen mit Freunden gespielt hatte, auf den Weg zu den Großeltern. Um den Kontakt mit Gopniks zu vermeiden, die möglicherweise im dunklen Wohngebiet herumlungerten und jemandem wie mir die letzten Rubel abknöpfen wollten, nahm ich den Weg durch die beleuchtete Fußgängerzone entlang des bereits geschlossenen Basars.
Bei den Großeltern angekommen, machte mir meistens Gogi die Tür auf.
»Oooh, Sanyok ist da!«, freute er sich, mich zu sehen. In der Wohnung empfing mich der Duft nach Essen, der mich stets an Usbekistan erinnerte. Galja hatte schon gespürt, dass ich gleich kommen werde, und deshalb bereits mein Lieblingsessen, leckere Pelméni, gekocht.
»Sanyok, setz dich, ich habe dir Pelmeschki gemacht«, sagte sie zu mir und stellte einen vollen Teller und ein Glas Smetana auf den Tisch.
Nachdem ich mich vollgestopft hatte, musste ich dringend duschen. Verschwitzt vom Spielen, mit dreckigen Knien und Händen – in diesem Zustand durfte ich keinesfalls auf die weißbezogene Matratze. Galja und Gogi wollten immer, dass ich meinen Rücken gut sauber machte. Dazu klopfte Gogi manchmal an der nicht abschließbaren Badezimmertür, kam dann sofort hinein, nahm einen eingeseiften, rauen Schwamm und schrubbte damit meinen Rücken. Es war mir unangenehm, in seiner Anwesenheit nackt zu sein. Deshalb verdeckte ich dabei meinen Lümmel mit den Händen, bis Gogi wieder ging.
Manchmal, wenn ich vor dem Spiegel stand und meine Haare föhnte, verdunkelte sich meine Sicht, bis ich kaum noch etwas erkannte. Mir wurde schwindelig. Sobald ich mich in die Hocke begab und ein paar Sekunden so sitzen blieb, verschwand dieses Schwindelgefühl wieder. Ich war es schon gewohnt, denn das passierte mir immer, wenn ich zu lange dem heißen Wasser ausgesetzt war. Insbesondere beim Baden. Deshalb hatte ich keine Angst. Nachdem ich wieder klar sehen konnte, zog ich mich am Waschbecken auf die Beine und schmiss mich im Wohnzimmer sofort auf die kühle Matratze.
Das Licht war aus, der Fernseher an. Kurze Zeit danach kam Galja aus der Küche zu mir und setzte sich mit gestreckten Beinen auf die Matratze. Ich legte meinen Kopf in Galjas Schoß. Sie tauchte ein Wattestäbchen in die Cremedose ein und putzte mir das erste Ohr.
»Aua, Galja, nicht so tief. Das tut weh!«, beschwerte ich mich, während Galja in meinem Ohr herumstocherte.
»Oi oi oi, Sanyok, deine Ohren sind ja dreckig«, sagte Galja und machte unbeirrt weiter. Nachdem sie meine Ohren geputzt hatte, massierte sie mir noch meine Füße, während sie eine Krimiserie im Fernsehen schaute.
Gogi saß währenddessen auf dem Balkon, rauchte eine Zigarette und trank dazu meistens ein Bier. Das eine oder andere Mal gab es dazu auch getrockneten, geräucherten Fisch. Nach der Fußmassage ging Galja oft auch auf den Balkon, um eine zu rauchen.
Manchmal drang der Zigarettengeruch in die Wohnung ein und bewog mich dazu, ebenfalls nach draußen zu gehen und Galja zu überzeugen, mich wenigstens ein einziges Mal an der Zigarette ziehen zu lassen.
»Biiiiiitte Galja, ich rauche sowieso mit meinen Freunden.«
»Ach Sanyok, Rauchen ist ungesund. Mach das nicht«, redete Gogi dazwischen, während er riesige Rauchschwaden aus seiner Nase atmete und dabei den letzten Schaum aus dem Bierglas wegschlürfte.
»Na gut, aber sag es nicht deiner Mutter«, gab Galja schließlich nach und reichte mir die Zigarette.
Ich nahm einen tiefen Zug und ließ den Rauch in meiner Lunge verweilen. Benebelt schaute ich auf die selten befahrene Straße unterhalb des Balkons. Direkt gegenüber gab es einen kleinen Lebensmittelladen, der weniger einem Supermarkt, als einem größeren Kiosk glich. Galja kaufte mir dort manchmal Süßigkeiten, Cola mit Chips oder anderes ungesundes Zeug, wenn ich beim Fernsehen Lust auf etwas zu knabbern bekam.
Wenn Gogi die Zigarette zu einem Stummel durchgeraucht hatte, gingen wir wieder rein, um irgendwelche Krimiserien auf NTV zu schauen. Ich lag zwischen Galja und Gogi auf der Matratze, bis mir langweilig wurde und ich auf die Idee kam, auf Bruce Lee zu machen. Ich holte eine leere anderthalb-Liter-Plastikflasche aus der Küche und drückte sie Gogi in die Hand.
»Hier Gogi, halt mal fest.« Ich ließ ihn die Flasche am Hals festhalten. Dann machte ich den ersten seitlichen Tritt. Mit dem anderen Bein setzte ich einen zweiten Tritt hinterher. Ich kickte abwechselnd, jedes Mal stärker, bis Gogi die Flasche nicht mehr halten konnte und sie weggeschleudert wurde.
»Ohoho Sanyok, kräftig kannst du treten.«
Gogi mochte es sehr, wenn ich meine selbsterdachten Karatemoves vorführte.
Gegen Mitternacht war der Fernseher noch leise an. Galja und Gogi waren bereits am Dösen. Ich war noch wach und aß eine Scheibe Brot mit einer dicken, gesalzenen Schicht Smetana. Plötzlich ertönte ein Stöhnen aus dem Fernseher.
»Oh ja, uuh ooh, ruf mich an.« Eine halbnackte, gut bestückte Frau räkelte sich auf dem flimmernden Bildschirm. Schnell flitzte ich zum Fernseher, um ihn auszumachen, bevor Galja und Gogi von diesem peinlichen Stöhnen aufwachten.
Die letzte Lichtquelle, die mich vom Schlafen abhielt, war damit verloschen. Das Einzige, was man noch sehen konnte, war das gedimmte Laternenlicht vom Kiosk draußen. Während ich dieses mystische Licht anstarrte, wurden meine Augenlieder immer schwerer und schwerer…
Als die ersten Sonnenstrahlen durch das Balkon- und Küchenfenster in die Wohnung fielen und mich weckten, hörte ich bereits, wie Gogi in der Küche etwas vor sich hin murmelte. Er sprach ein Gebet, wie er es jeden Morgen tat, bevor ich wach wurde. Nach dem Gebet bereitete Galja ein Frühstück mit Spiegelei, Brot und Tee zu.
»Sanyok, ich wollte dir noch so eine silberne Kette mit einem Kreuz schenken«, sagte Gogi beim Essen zu mir. »Vielleicht bekommst du sie zum Geburtstag.«
Nach dem Frühstück fuhr ich mit Gogi in der Marschrutka zur Kirche. Dort kauften wir in einem kleinen Laden ein paar Bienenwachskerzen und zündeten sie dann in der Kirche an. Ich hielt nicht so viel vom Glauben, doch der Geruch der kürzlich angezündeten Kerzen, die prunkvollen Wände um mich herum, der tiefe Gesang von Batjuschka und der intensive Geruch von Weihrauch waren atemberaubend. Nachdem wir die Kerzen angezündet hatten, füllte Gogi noch eine mitgebrachte Plastikflasche mit Weihwasser und wir machten uns wieder auf den Rückweg.
Es war Zeit, nach Hause zu meinen Eltern zu gehen, sonst würde sich meine Mutter Sorgen machen. Schließlich besaßen weder ich, noch Galja und Gogi ein Telefon.
Ich wollte nur ungern zurück nach Hause. Stattdessen meldete ich mich kurz bei Mama und spielte dann draußen weiter mit Igor, Sanja und den anderen.
Mittlerweile stritten sich meine Eltern jeden Tag und es war mir unangenehm, sie in diesem Zustand zu ertragen. Während der Woche kam mein Vater erst um Mitternacht von seiner neuen Arbeit nach Hause. Dima wurde nämlich eine Stelle als Nachrichtensprecher beim regionalen Fernsehsender DON-TR angeboten, die er, ohne zu zögern, annahm. Dafür musste er aber jeden Tag in die vierzig Kilometer entfernte Stadt Rostow reisen. Einen Führerschein hatte mein Vater nicht, auch, wenn er einen machen oder billig hätte kaufen können. Das Auto selbst konnten wir uns nicht leisten. Deshalb nutzte Dima Marschrutkas am Bahnhof um die Ecke.
»Wo warst du? Hast du wieder diese Prostituierte von der Arbeit gefickt?«, schrie Mama meinen Vater an. »Was behauptest du wieder für einen Blödsinn?«, erwiderte Dima und versuchte, in ein anderes Zimmer zu verschwinden, während Mama ihm hinterherlief und ihm weiter Vorwürfe machte. Ich saß still mit der kleinen Mascha im Wohnzimmer. »Aaah, ich rufe gleich die Polizei«, hörte ich meine Mutter aus dem Schlafzimmer schreien.
»Saschenka, ruf die Polizei. Vater schlägt mich.«
Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Dann kam ich auf den Gedanken einen Blick ins Schlafzimmer der Eltern zu werfen, um zu schauen, ob Dima sie wirklich schlug. Mama saß auf dem Boden.
»Sanyok, sie ist krank«, sagte Dima völlig aufgebracht und wechselte wieder das Zimmer.
Manchmal gab es Tage, da stand ich mitten im Gefecht meiner Eltern. Manchmal beschützte ich meine Mutter, indem ich sie heulend umarmte, wenn mein Vater sie etwas härter anfassen wollte, weil seine Worte ihr gegenüber nichts brachten.
Von Tag zu Tag spürte ich, wie meine Eltern sich zunehmend voneinander entfremdeten. Nichts war mehr so wie früher. Es gab keine gemeinsamen Frühstücke mehr. Kein Geruch des von Dima aufbereiteten Kaffees am Morgen. Auch das Verhältnis zwischen den Großeltern mütterlicher- und väterlicherseits wurde deutlich schlechter, bis sie komplett verfeindet waren. Galja und Dima gaben Oma Lina die Schuld – insbesondere an den Streitereien meiner Eltern. Galja meinte, sie hätte immer Mama und Dima gegeneinander ausgespielt. Dima nannte Oma Lina bei Gesprächen mit mir Kuwalda, was übersetzt »schwerer Hammer« heißt. Der Spitzname war eine Anspielung auf die Statur von Oma Lina. Obwohl sie viel am Hof und in der Küche arbeitete, war sie dick, was sie immer mit ihrer Schilddrüsenerkrankung begründete.
»Schau dir diese Scheiße an«, sagte Oma Lina zu Dima im Fernsehen, als wir bei Lina und Yura in Kharkovskiy zu Besuch waren. Immer wenn wir da waren, schaute sie um 21 Uhr Nachrichten. Und wer war da als Nachrichtensprecher zu sehen? Dima. Ihr Hass auf Dima war nicht mit Worten zu beschreiben und machte auch vor mir keinen Halt. Wahrscheinlich, weil ich Dima ähnlichsah. Bei jedem Zoff zwischen Mascha, Lina und mir war Mascha die Gute und ich war die sogenannte jüdische Fufaevsche Ausgeburt.
Bei Galja war es eher andersherum: Es kam mir so vor, als würde sie mich mehr mögen als Mascha. Deshalb stand ich meist auf der Seite von Dima, Galja und Gogi. Trotzdem empfand ich auch Mitgefühl für meine Mutter, wenn Dima ihr gegenüber wieder etwas Negatives äußerte. Ich widersprach ihm aber nie, aus Angst, unsere Beziehung zu verschlechtern. Genauso widersprach ich meiner Mutter nicht, weil ich sie liebte.
Schon bald war unsere Wohnung, wie Kriegsgebiet, verlassen. Mama, Mascha und ich zogen nach Kharkovskiy ins Haus von Yura und Lina, während mein Vater eine Wohnung in Rostow mietete. Nach zehn Jahren Ehe ließen sich meine Eltern scheiden.
 Unser Wohnzimmer am Petrovsky Boulevard.
Unser Wohnzimmer am Petrovsky Boulevard.
Zukünftiges Learning aus den Streitereien meiner Eltern: Bevor ich Vater werde, werde ich zuerst darüber nachdenken, ob ich in schwierigen Beziehungsphasen in der Lage bin, meinen Kindern kein Trauma zu hinterlassen.