Gottespfad - Über mich - Lebensstil - 📚 Bücher - ❤️ Spenden
Tagebuch: vor 1992 - 1992/98 - 1998/99 - 1999/2002 - 2002/03 - 2003/05 - 2005/07 - 2008/10 - 2011/13 - 2014 - 2015 - 2016/19 - 2019/21 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025
2005/07: Auswandern nach Deutschland und erste Zeit dort
 Ich spiele mit meiner Schwester das Computerspiel 'Arcanum' in meinem Zimmer über LAN. (Lühnde 2006/2007).
Ich spiele mit meiner Schwester das Computerspiel 'Arcanum' in meinem Zimmer über LAN. (Lühnde 2006/2007).
Der 25. März 2005. Am frühen Morgen setzten wir die Reise ohne Opa mit dem Flugzeug nach Deutschland fort. Nach einem dreistündigen Flug erreichten wir schließlich Frankfurt. Wir verließen das Flugzeug und begaben uns zum Empfangsbereich, wo eine große Menschenmenge auf die Ankommenden wartete. Unter den Personen, die ganz vorne standen, entdeckte ich Joachim. Meine Mutter ging direkt auf ihn zu und umarmte ihn als Erste. Ich folgte ihr und umarmte auch ihn, fühlte mich jedoch leicht unsicher, da ich nicht wusste, wie ich mich ihm gegenüber verhalten sollte. In diesem Moment fühlte es sich jedoch nicht so schwer an, ihn als Teil unseres neuen Lebens zu akzeptieren. Besonders als wir zum Parkplatz gingen und ich dort seinen luxuriösen 7er BMW sah. In Russland hatte ich immer das Gefühl, dass nur wohlhabende Mafiosi solche Autos besaßen. In Deutschland schien es jedoch normal zu sein, denn alle Autos auf dem Parkplatz sahen beeindruckend aus.
Als wir uns in seinen BMW setzten, fragte ich mich neugierig, wofür all die Knöpfe und leuchtenden Anzeigen da waren. Im Vergleich zu Opas LADA wirkte die hochmoderne Innenausstattung des BMW wie etwas direkt aus einem Science-Fiction-Film entsprungen.
Von Frankfurt aus machten wir uns auf den Weg in Richtung Hannover. Nach einer langen, aber spannenden Fahrt auf der deutschen Autobahn ohne Geschwindigkeitsbegrenzung, erreichten wir schließlich Lühnde. Als wir aus dem Auto stiegen, standen wir vor Joachims Haus, das nun unser neues Zuhause werden sollte.
Kaum hatte ich das Haus mit staunenden Augen betreten, als an der Tür ein großer Mann und ein kleiner Junge klingelten. Es waren unsere Nachbarn Jörg und sein Sohn Jan, der ein paar Jahre jünger war als ich. Obwohl sie die ganze Zeit auf Deutsch sprachen, konnte ich kein einziges Wort verstehen. Nachdem sie sich verabschiedet hatten, hatte ich endlich die Gelegenheit, das Haus ein wenig zu erkunden. Eine Treppe im eigenen Haus - das war etwas ganz Besonderes! Und zwei Toiletten, sowie so viele Zimmer! Weiter kam ich mit meiner Erkundungstour leider nicht, denn die schlaflose Nacht am Flughafen und die Autofahrt hatten mich geschlaucht und ich war hundemüde.
Am nächsten Morgen setzte ich meine Erkundungstour im Haus fort. Mein Zimmer befand sich direkt links hinter der Eingangstür. Die Treppe führte nach oben zum Wohnzimmer, den Schlafzimmern der Eltern, Halbschwesters und Schwesters Zimmer sowie Joachims Büro. Im unteren Teil des Hauses befanden sich die Küche, das Esszimmer mit seinen antiken Stühlen, das Badezimmer und die Werkstatt, in der Joachims Motorrad stand und wo er immer rauchte.
Die ersten Abende in Deutschland waren für mich zutiefst schmerzhaft, denn die Sehnsucht nach Dima und den anderen war einfach zu groß. Einsam lag ich im Bett, starrte in die Decke und vermisste die vertrauten Gesichter, die Witze meines Vaters und die Abenteuer mit Onkel Sascha. Ich fühlte mich verloren in diesem neuen Land, das mir noch so fremd war.
Doch es blieb mir keine andere Wahl, als mich auf dieses unbekannte Leben einzulassen und darauf zu hoffen, dass es mit der Zeit erträglicher werden würde.
Die Förderklasse
Nach einer kleinen schulfreien Eingewöhnungsphase von zwei Wochen musste ich in die Schule. Da ich kein Deutsch konnte, meldeten Mama und Joachim mich in einer Sprachförderklasse an, die von der Geschwister-Scholl-Schule in Hildesheim angeboten wurde.
Am ersten Schultag fuhr ich zusammen mit Mama mit dem Bus nach Hildesheim und von dort aus mit einem zweiten Bus zur Schule, um mich an den Schulweg zu gewöhnen. In der Schule wurde ich von meiner Klassenlehrerin, Frau Schlömer, der Klasse vorgestellt und dann ging es direkt mit dem Deutschlernen los: Kurze Sätze vorlesen und diktierte Wörter aufschreiben. In der Pause lernte ich die Russen Max und Maxim kennen, aber auch meine Klassenkameraden David und seine Schwester Sabrina aus Polen, Kerim und seine zwei Schwestern aus der Türkei, sowie Mütterchen und Tanja, die ebenfalls aus Russland stammten.
Nach Schulschluss folgte ich einfach den anderen Schülern, die mich glücklicherweise zur richtigen Haltestelle führten. Von dort aus fuhr ich denselben Weg zurück zum Hildesheimer Hauptbahnhof, wo so viele Schüler auf die Busse warteten, dass ich zuerst Schwierigkeiten hatte, den richtigen Bus nach Hause zu finden. Mithilfe eines auswendig gelernten Satzes, den ich mit meinem starken, russischen Akzent vortrug, fragte ich schließlich einen Busfahrer nach dem Weg, und er half mir, die richtige Haltestelle zu finden. Nach einer halbstündigen Fahrt kam ich endlich, mit ein paar Stunden Verspätung, zu Hause an. Es war ein sehr anstrengender und stressiger erster Schultag in Deutschland.
 Meine Sprachförderklasse und die ersten Freunde, Max und Maxim. (Klassenfoto, 2005)
Meine Sprachförderklasse und die ersten Freunde, Max und Maxim. (Klassenfoto, 2005)
Dokumente
Meine Schrift auf Deutsch - Diktat vom 12. Dezember 2005 (JPG)
Geschwister-Scholl-Schule - Leistungsstand - 13. Juli 2005 (JPG)
Doch nicht nur der Schultag war anstrengend, sondern auch Joachims Regeln. Ich musste schon um zehn Uhr ins Bett gehen, mich im Auto anschnallen und bei Tisch stets warten, bis alle mit dem Essen fertig waren, während er seine Nase putzen durfte. Auch musste ich mich erst daran gewöhnen, abends nicht länger Omas Brot, sondern sogenannten Toast zu essen, den ich nicht mochte. Noch dazu schmeckten der Käse und die Wurst, mit denen ich das Brot belegte, irgendwie anders als in Russland. Das wirkte sich insbesondere auf meine Verdauung und den Filmeabend am Wochenende aus. Wenn Joachim während des Films auf dem Sofa einschlief und laut zu schnarchen anfing, musste ich nur einmal pupsen, um ihn zu wecken. Selbst ein leiser Pups war so dermaßen schlimm, dass Joachim davon aufwachte und zu meiner Mutter ins Schlafzimmer floh, während ich mein Lachen erfolglos zu unterdrücken versuchte. Das hatte ich von ihm gelernt. Was raus muss, muss raus – wie er immer sagte.
Manchmal waren Mama, Joachim und Schwester unterwegs und ich musste auf die kleine Halbschwester, die kaum krabbeln konnte, aufpassen. Wenn sie die Windel vollmachte, trug ich sie vorsichtig nach unten ins Badezimmer, um dort die Windel zu wechseln. Ich legte sie auf den Klodeckel, zog die alte Windel aus und als ich mich nach der neuen Windel umschaute, stellte ich fest, dass sie außerhalb meiner Reichweite war. Halbschwester lag still auf dem Klodeckel, sodass ich davon überzeugt war, dass nichts passieren würde, wenn ich sie nur für eine Sekunde losließ, um schnell die Windelpackung zu schnappen.
*BUMMM* Als ich die Windelpackung in der Hand hielt, hörte ich einen Knall und dann plötzlich ein lautes Heulen. Halbschwester war vom Klodeckel auf den harten Kachelboden gefallen. Mir rutschte die Windelpackung aus der Hand während mich gewaltige Angst überkam. Was, wenn sie sich bei dem Sturz etwas gebrochen hatte? Vorsichtig hob ich sie wieder auf den Klodeckel und stimmte in ihr Heulen ein, während ich sie gut festhielt und überprüfte, ob ihre Glieder in irgendeiner Weise schief standen. Als sie nach einer Weile endlich aufhörte, zu weinen, konnte ich mich auch beruhigen. Am nächsten Tag hatte sie einen riesigen blauen Fleck entlang ihres Beines. Mama wunderte sich, woher er kam, doch von dem Vorfall erzählte ich ihr erst einige Jahre später.
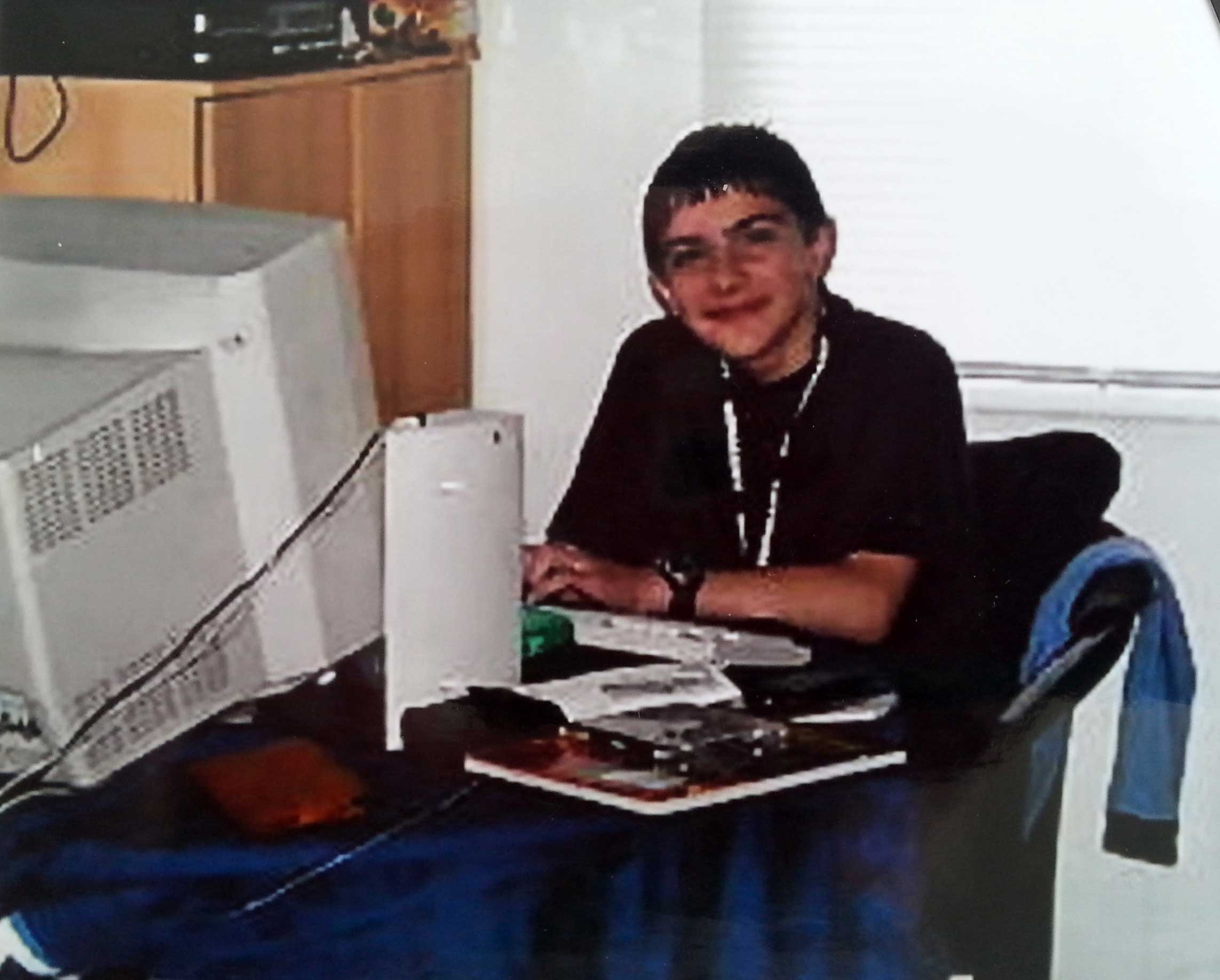 Ich an meinem ersten Computer.
Ich an meinem ersten Computer.
Alexey
Mit der Zeit gewöhnte ich mich an die Schule, an Joachims Regeln und an Deutschland. Klar, in den Pausen gab es oft Stress mit Schülern anderer Nationalitäten – manchmal sogar innerhalb der eigenen Klasse. Aber ich war im Hinblick auf solche Konflikte schon abgehärtet und im Vergleich zu meiner Schule am Petrovksy Boulevard waren die Reibereien hier bloß Kinderkram.
In der Pause saß ich meistens mit Max und Maxim zusammen und genoss mein Käsebrötchen, das ich für nur fünfzig Cent von meinem Taschengeld kaufte. Manchmal besserte ich mein Taschengeld auf, indem ich ein paar Münzen aus einer großen Vase voller Kleingeld entwendete, die im Schlafzimmer meiner Eltern stand.
Einmal kamen ein paar andere Russen an unserer Sitzbank vorbei und schüttelten uns die Hände, obwohl ich sie gar nicht kannte. Max und Maxim stellten mich ihnen vor. Diese Jungs waren schon in der fortgeschrittenen Sprachförderklasse. Unter ihnen befand sich auch Alexey, der später mein bester Freund hier in Deutschland wurde. Er war einen Kopf größer als ich, schlank, hatte blonde Haare und stammte ursprünglich aus Sibirien. Maxim hatte ebenfalls blonde Haare und war etwas kräftiger als wir. Max, hingegen, hatte kurze braune Haare und war einen halben Kopf größer als ich. Alle waren einige Jahre älter als ich.
Seit ich Max, Maxim, Alexey und den anderen Russen Gothic ausgeliehen hatte, war das Spiel das einzige Gesprächsthema in den Schulpausen.
»Ich war im Wald und da waren Orks!«, erzählte uns Alexey auf Russisch. Gothic war reich an Dialogen und Texten, die wir natürlich erst verstehen mussten, um weiterzukommen. Das Spiel half uns allen, unsere Deutschkenntnisse zu verbessern – jedoch nicht schnell genug für unsere Lehrer, wie aus meinem Leistungsstand ersichtlich war:
»[…] Er kam mit geringen Deutschkenntnissen in die Klasse. Er verständigt sich mit den Mitschülern auf Russisch. Bisher hat er wenig erkennbare Fortschritte gemacht. Er erledigt die ihm gestellten Arbeitsaufgaben zwar konzentriert, aber nur mit äußerst geringem Lerntempo. Alexander kann Texte fast flüssig lesen und zum Teil verstehen.
Er schreibt Texte fast fehlerfrei ab und geübte Diktate mit relativ wenig Fehlern. Er hat noch immer Probleme mit der lateinischen Schrift, speziell mit der Unterscheidung von Groß- und Kleinbuchstaben.
Alexander erfasst grammatische Zusammenhänge selbstständig und kann sie, wenn er sich bemüht, anwenden. Es fällt Alexander immer noch nicht leicht, sich in das deutsche Schulsystem einzufügen. Er kommt häufig zu spät und fertigt Hausaufgaben nicht regelmäßig an.«
Gothic
Wir übernahmen scherzhaft die Dialoge aus Gothic. Einmal schrie ich Max vor dem Einsteigen in den Bus zu: »Na warte, Du Lump!« und kicherte vor mich hin. Oder sagte zur Verkäuferin in der Cafeteria: »Zeig mir Deine Ware«. Doch anstelle von Drogen gab ich mein Geld für fettige Käsebrötchen aus.
Nachdem wir Gothic durchgespielt hatten, waren wir von der Story und den ganzen Abenteuern so überwältigt, dass wir uns sofort nach einer Fortsetzung erkundigten. Es gab tatsächlich einen zweiten Gothic-Teil. Jeder von uns kaufte sich das Spiel. Leider war mein noch mit Röhrenbildschirm ausgestatteter Computer zu langsam für Gothic II. Immerhin war es bloß ein alter Kasten, den Joachim nicht mehr brauchte. Ich war deshalb auf die anderen neidisch, weil sie mit ihren leistungsfähigen Computern bereits viel weiter im Spiel waren. Doch irgendwann kaufte mir Mama auch einen neuen Computer, den ich mir bei Media Markt selber aussuchen durfte. Er hatte sogar einen Flachbildschirm!
Mit dem neuen Rechner traute ich mich, meine russischen Freunde zu mir nach Hause einzuladen, wo wir LAN-Partys veranstalteten. Wir spielten Ballerspiele wie Counter-Strike 1.6 und die besten Strategiespiele, wie Age of Empires II und Empire Earth.

Wenn jemand von uns Geburtstag hatte, wurde ich immer eingeladen; auch, wenn ich nicht immer dabei sein wollte, weil sich üblicherweise alle besoffen. Ich mochte zu dieser Zeit keinen Alkohol, insbesondere keinen Wodka. Wenn ich es mir aussuchen konnte, trank ich lieber ein kaltes Bier oder noch besser: Rotwein. Hauptsache, es schmeckte nicht nach Desinfektionsmittel.
Zu Maxims Geburtstag konnte ich mir den Alkohol leider nicht aussuchen. Es gab nur Wodka. Das führte dazu, dass ich mich nach über zehn Kurzen zum allerersten Mal übergeben musste; und das ausgerechnet in einer Bar – direkt auf ein Sofa. Max und Maxim trugen mich nach Hause zu Maxim, während ich laut das Lied »Weiße Rosen« von Jurij Schatunov lallte. Wir vier wurden in dieser Zeit echt gute Freunde, auch, wenn unsere Freundschaft von gegenseitigen – insbesondere sexuell angehauchten – Beleidigungen und Sprüchen gezeichnet war. Zusammen mit Max und Maxim überstand ich das erste Halbjahr der fortgeschrittenen Förderklasse. Im zweiten Halbjahr wurde ich aber ohne meine Freunde – mit der Empfehlung meiner Lehrerin – in die achte Hauptschulklasse geschickt, um dort die erworbenen Deutschkenntnisse unter Beweis zu stellen. Mein bisheriger Leistungsstand wurde wie folgt von meinen Lehrern kommentiert:
»[…] Obwohl er inzwischen so viele Vokabeln und Redewendungen gelernt hat, dass er sich mit seinen Mitschülern problemlos auf Deutsch unterhalten könnte, benutzt er überwiegend die russische Sprache. Er ist oft unkonzentriert und abgelenkt. Alexander sollte sich aktiver am Unterricht beteiligen. Alexander kann unbekannte Texte flüssig lesen, ihren Sinn weitgehend erfassen und mit eigenen Worten wiedergeben. Er schreibt Texte fehlerfrei ab und macht in geübten Diktaten relativ wenige Fehler. An seinem Schriftbild muss er noch arbeiten. Grammatikalische Zusammenhänge erfasst er selbstständig und kann sie anwenden. Wie im Deutschunterricht sollte er auch in Mathematik aktiver und seinen Fähigkeiten entsprechend mitarbeiten. […]«
Dokumente
Zeugnis - Leistungsstand vom 27. Januar 2026 - Geschwister-Scholl-Schule
Deutsche Klasse
Das zweite Halbjahr in einer richtigen deutschen Hauptschulklasse war nicht so erfolgreich, weil ich die Lehrer sprachlich noch nicht komplett verstand und ich die im Leistungsbericht niedergeschriebene Kritik meiner Lehrer auch nicht besonders ernst nahm. Außerdem machten Computerspiele viel mehr Spaß als Schule. Wenn ich mich nicht gerade hinter dem Computer verschanzte, spielte ich mit dem Nachbarskind Jan und seinen Freunden manchmal Fußball. Das Gute am Fußball war, dass wir nicht miteinander reden mussten. Es war nämlich schwierig für mich, alles zu verstehen, was die Jungs sagten.
Manchmal luden uns die Nachbarn auch zum Grillen ein. Dort verstand ich dann gar nichts mehr von dem, was die Erwachsenen redeten. Beim Grillen war auch Jans ältere Schwester, Lisa, dabei, die ich ziemlich hübsch fand. Wir hatten miteinander überhaupt nichts zu tun, vor allem, weil ich immer schnell wegschaute, sobald sie in meine Richtung sah.
Das letzte Mal, dass ich ihr tief in die Augen blickte, war von meinem Zimmer aus, als ich hörte, dass jemand direkt vor meinem Fenster mit einem Ball spielte. Also spähte ich kurz zwischen den Lamellen des Rollos hindurch und sah Lisa, die mit ihrem Bruder Basketball spielte. Ich starrte sie die ganze Zeit an, während sie direkt vor meinem Fenster dribbelte. Plötzlich drehte sie sich zu meinem Fenster und erwischte mich. Ich fand das so extrem peinlich, dass ich von dem Moment an immer versuchte, ihr aus dem Weg zu gehen. Mit Jan hatte ich seitdem auch weniger zu tun.
Zeugnis von Alexander Fufaev aus der Klasse 8d - Geschwister-Scholl-Schule - 2006
Vom Bauer zum Computernerd
Aufgrund meiner schlechten Deutschkenntnisse, insbesondere wegen der Unfähigkeit, mit anderen richtig zu kommunizieren, isolierte ich mich von der Außenwelt und flüchtete in die Welt der Computerspiele. Diese Phase der Isolation veränderte nach und nach meine Persönlichkeit. Doch ich glaube, wenn ich statt Max, Maxim und Alexey falsche Freunde kennengelernt hätte und nicht so einen guten Stiefvater gehabt hätte, dann wäre aus mir kein Computernerd geworden, sondern vielleicht ein Junkie oder ein Krimineller. Meinen russischen Kumpels und den anderen Ausländern an meiner Schule, die ja ebenfalls ohne jegliche Sprachkenntnisse in einem fremden Land gestrandet waren, ging es ähnlich. Manch einer war ständig aggressiv, ein anderer machte einen dicken Deutschen mit Brille fertig, der nicht an Gott glaubte. Dann waren da noch die ganzen Draufgänger und wir - die kulturellen Außenseiter. Jeder war das Ergebnis seines sozialen Milieus. Ich hatte echt Glück, dass ich mich mit vernünftigen Leuten und nicht mit Gopniki anfreundete.
 In meinem Zimmer. Ich spiele über LAN mit meiner Schwester das Spiel namens Arcanum (2007)
In meinem Zimmer. Ich spiele über LAN mit meiner Schwester das Spiel namens Arcanum (2007)
Zukünftiges Learning aus dem Auswandern: Der wichtigste Schritt, um eine Person in einer fremden Gesellschaft (mit einer anderen Sprache und Kultur) zu integrieren, besteht darin, sie mit bereits integrierten Menschen in Kontakt zu bringen.
Sommer, 2007. In den Sommerferien reisten Mama, Halbschwester, Schwester und ich für ein paar Wochen mit dem Zug nach Russland, um unsere Verwandten wiederzusehen. Von Hannover aus, wo uns Joachim verabschiedete, ging unsere Fahrt über Polen und die Ukraine nach Moskau.
In einem engen Zugabteil, das mit einem Doppelbett und einem kleinen Tisch ausgestattet war, verbrachten wir die zweitägige Reise. Viel Beschäftigung hatten wir nicht. Die meiste Zeit lag ich im Bett und las einen Fantasy-Roman, den ich normalerweise nie angerührt hätte. Ich musste das Buch wohl irgendwann mal von meinem Vater zum Geburtstag bekommen haben, denn direkt auf der ersten Seite stand eine kurze, mit Kugelschreiber verfasste Widmung von Dima. Sowas machte er immer, wenn er mir Bücher schenkte. Leider las ich die Bücher selten. Voller Begeisterung und von einem schön gestalteten Buchcover in den Bann gezogen, fing ich oftmals an, die ersten Seiten zu lesen, bis im Laufe der nächsten Tage ein neues Computerspiel mein Interesse zurückgewann. Das Buch geriet dann in meinem von Computerspielen dominierten Regal für immer in Vergessenheit. Auch dieses Mal reichte die Zugfahrt nicht aus, um den Roman bis zum Ende zu lesen.
Im Zug auf dem Weg nach Russland zu meinen Verwandten.
In Moskau erwartete uns Opa Yura, mit dem wir dann zusammen per Zug bis nach Rostow reisten. Dort holte uns Onkel Sascha mit einem neuen, dunkelroten Auto ab. Ich erkannte ihn im ersten Moment gar nicht, weil er jetzt eine Glatze hatte. Es war aufregend, mit ihm nach Hause zu fahren, weil er während der Fahrt immer ein Rennen anstiftete, indem er ein anderes Auto überholte und dann langsamer wurde, bis das andere Auto uns wieder überholte. Dann überholten wir es nochmal; möglichst mit Augenkontakt zum anderen Fahrer. Dies genügte meist, um sein Ego anzukratzen und ihn dazu zu bewegen, uns wieder überholen zu wollen; diesmal jedoch unabhängig davon, wie schnell wir fuhren. Dann begann das Rennen – ganz ohne Sicherheitsgurt.
In Kharkovskiy angekommen, war das rote Auto von Opa Yura nicht mehr da. Stattdessen stand neben dem dunkelroten Opel Vectra von Onkel Sascha Opas neues Auto – ebenfalls ein Opel Vectra, aber in Dunkelblau. Die Großeltern hatten anscheinend eine erfolgreiche Ernte gehabt, während wir in Deutschland waren. Cousine Ksjuscha, Tante Olja, Onkel Sascha und ihr kleiner Sohn Yura sowie Oma Lina empfingen uns mit großer Freude und einem reich gedeckten Tisch. Es war ein unbeschreiblich tolles Gefühl, wieder auf dem Hof zu sein, Ksjuscha und die anderen, vor allem meinen Onkel Sascha, zu sehen und mit ihm eine zu rauchen, während wir an der Technik herumschraubten. Onkel zeigte mir sein neues Auto und wie er es aufmotzen möchte: Mit neonfarbener Beleuchtung unter dem Wagen, einem Spoiler hinten und schwarzen Felgen. Seine Lieblingsmusik von Jurij Schatunov oder Victor Coy spielte, während er mir das Innere des Autos zeigte.
 Am Tisch bei den Großeltern.
Am Tisch bei den Großeltern.
Großvater mit meinen Schwestern füttern die Enten.
Ich mit meinen Schwestern in Asow.
Yura, der Sohn von Tante Olja und Onkel Sascha, war ein Jahr älter als Halbschwester und schon echt groß. Die beiden alberten gern miteinander herum. Ein paar Tage später wurden sie gleichzeitig in einer orthodoxen Kirche in Asow getauft.
Nach der Zeit bei den Großeltern in Kharkovskyi besuchten Schwester und ich für eine Woche Galja und Gogi in Asow. Gogi schenkte mir auch eine silberne Kette mit einem Kreuz, die er mir damals versprochen hatte.
In Asow klingelte ich auch bei meinen Freunden. Viele von ihnen wohnten nicht mehr da und ich wusste nicht, wohin sie verschwunden waren. Nur mein Freund Sanja wohnte noch dort, öffnete mir die Tür und freute sich riesig mich wiederzusehen.
Nachdem ich den Tag mit ihm verbracht hatte, wurde es dunkel und ich musste nach Hause. Normalerweise wäre ich so spät nicht mehr alleine unterwegs gewesen, doch ich verspürte den Drang, die abendliche Atmosphäre der Stadt noch einmal zu erleben. Ich streifte also noch ein bisschen durch Asow, setzte mich auf eine Bank; an einem Ort, der die ganzen Erinnerungen an meine schöne Zeit in Russland wiederbelebte. Die Straßen, durch die ich einst mit meinen Freunden gebummelt war... Der Park und die Allee, die mich direkt zum Fluss Don führte. In diesem nostalgischen Moment war ich wieder der kleine Junge, der mit seinen Freunden die größten Abenteuer erlebte. Ich kam auf den Gedanken, in Russland zu bleiben. Zu weh tat die Vorstellung, alle zu vermissen, sobald wir nach Deutschland zurückreisten. Ich war fest überzeugt, meiner Mutter zu sagen, dass ich nicht mit nach Deutschland kommen würde, sondern bei Dima in Russland bleiben würde.
Nach dem Besuch bei Galja und Gogi in Asow holte uns Dima zu sich nach Rostow. Er wohnte mittlerweile in einer Zweizimmerwohnung mit seiner Freundin Lena, die er vor einiger Zeit auf der Arbeit kennengelernt hatte. Meine Überlegungen, bei meinem Vater zu bleiben, verstärkten sich über die Dauer dieses Besuchs. Wir unternahmen so viel zusammen, lachten so viel zusammen.
Die größte Überraschung war es, meinen Vater in seinem allerersten Auto zu sehen. Sein Chevrolet strahlte in der Sonne und hob sich von den vielen dunklen Autos ab. Wenn mein Vater – der im Gegensatz zu mir sehr groß war – auf dem Fahrersitz saß, kam es mir vor, als wäre das Auto viel zu klein für ihn. Sein Fahrstil war selbstbewusst. So selbstbewusst, dass man dachte, er würde schon sein ganzes Leben lang fahren.
Mit seinem gelben Chevrolet brachte er uns – nach der Zeit bei ihm – nach Kharkovskiy zurück. Als wir uns verabschiedet hatten, bekam ich einen dicken Kloß im Hals. Und je tiefer die Sonne stand, desto mehr staute sich in mir die Sehnsucht nach meinem Vater an. Erst am Abend, als mein Onkel nach Hause gegangen war, traute ich mich, meine Gefühle auszusprechen. Ich erzählte meiner Mutter, dass ich gerne in Russland bleiben würde. Als Oma Lina und Opa Yura das hörten, überredeten sie mich jedoch, meinen Plan nicht in die Tat umzusetzen. Sie sagten mir, dass ich hier keine berufliche Perspektive hätte. Und so flog ich wieder in das Land zurück, in dem ich nur ungern leben wollte…
Zurück in Deutschland
 Ich mit Stiefvater lasse ein Modellflugzeug steigen.
Ich mit Stiefvater lasse ein Modellflugzeug steigen.
 Im Garten mit meiner Familie grillen.
Im Garten mit meiner Familie grillen.
Ich hatte noch Ferien. Im Vergleich zum aufregenden Urlaub in Russland war es für mich in Deutschland jedoch langweilig. Deshalb tat ich das Einzige, was ich in diesem Land gerne tat: Ich flüchtete zusammen mit meinen Freunden Max, Maxim und Alexey in die Welt der Computerspiele. Dieses Mal in ein von Alexey kürzlich entdecktes Weltraumspiel namens DarkOrbit. Ich war später von diesem Spiel so besessen, dass ich mein Raumschiff per Telefonanruf verbesserte. Daraufhin kam eine Telefonrechnung von fünfhundert Euro ins Haus geflattert. Joachim war überhaupt nicht erfreut darüber und schrie mich zum allerersten Mal an. Das hatte ich zuvor noch nie erlebt. Ich bekam ein richtig schlechtes Gewissen, weshalb ich das Spiel nie wieder anrührte.
»Ich spiele DarkOrbit nicht mehr«, sagte ich zu Max per Skype, während wir Counter-Strike spielten.
»Du bist auch so blöd, so viel Geld für das Spiel auszugeben… Schau dir mal lieber dieses Spiel an.«
Mein Skype machte einen Benachrichtigungston. Er hatte mir einen Link geschickt.
»Schickst du mir wieder irgendwelches versautes Zeug?«
»Nein, wirklich nicht. Das ist ein krass schweres Labyrinth«, antwortete Max auf Russisch und lachte.
Ich minimierte Counter-Strike kurz und öffnete den Link. Er führte auf eine pechschwarze Seite mit der Überschrift Level 1. Darunter befand sich ein helles Labyrinth, entlang dem ich einen quadratförmigen Mauszeiger bewegen konnte.
»Du musst den Mauszeiger bis zum Ende des Labyrinths führen, ohne seine Wände zu berühren.«
Bevor er den Satz beendete, war ich schon beim zweiten Level. Nun war das Labyrinth etwas länger und nicht mehr überall gleich breit. Trotzdem durchquerte ich es ohne Probleme. Beim dritten Level war das Labyrinth noch viel länger und der Gang wurde zum Ende hin so schmal, dass wahrscheinlich schon ein kleines Zucken ausgereicht hätte, um zu scheitern.
Je näher ich den Mauszeiger zum Ziel bewegte, desto langsamer wurde ich. Ich lehnte mich etwas näher zum Bildschirm und wischte noch schnell meine verschwitzte Hand an der Hose ab. Wie in Zeitlupe bewegte ich mich in Richtung des Ziels, während Max im Hintergrund mal wieder etwas aß und dabei laut schmatzte. Ich wurde noch langsamer, noch vorsichtiger. Kurz vor dem Ende erschien etwas, das in meinem späteren Leben oft in meinen Träumen und Gedanken auftauchte. Ganz egal, ob ich gerade an die Schule, das Essen oder an Computerspiele dachte. Es erschien wie aus dem Nichts als ein scharfes Bild vor meinen Augen; genau in der Gestalt, wie ich es jetzt zum ersten Mal sah. Es war das Gesicht des Mädchens aus dem Film »Der Exorzist«, das von einem Dämon besessen war.
Vor meinen Augen, die zuvor noch konzentriert das Labyrinth angestarrt hatten, flackerten nun im Vollbildmodus ihre massakrierten Züge. Die Lautstärke des durchdringenden Kreischens, das sie beim Erscheinen von sich gab, verursachte in meinen Ohren für einige Minuten ein Piepen, auch nachdem ich die Kopfhörer abgesetzt hatte. Mein Herz raste und ich atmete hektisch. Kurze Zeit später, nachdem ich mich etwas beruhigt hatte, betätigte ich den roten Knopf an der Steckleiste und saß noch eine Weile wie erstarrt im Sessel. Dieses Gesicht ging mir auch die Tage danach nicht mehr aus dem Kopf. In mir kam immer das komische Gefühl auf, als wäre dieser Dämon auf mich übergesprungen. Erst, als die Ferien sich dem Ende neigten, versteckte sich diese Erinnerung allmählich in den Tiefen meiner Gedanken.
Hauptschüler
2007. Als die Ferien vorbei waren, besuchte ich die Molitoris-Schule in Harsum, nicht weit von Lühnde entfernt. Anfangs ging ich ungern dahin, weil ich dort noch niemanden kannte. Es gab sogar eine Russin, Kristina, in meiner Klasse, mit der ich auf Russisch reden könnte, was ich aber wegen ihres Freunds Ivan nicht tat. Wenn er den Eindruck gewann, dass ich mit ihr flirtete, wäre ich erledigt. Mit meinem neuen Klassenlehrer, Herrn Wiezer, war auch nicht zu spaßen. Er war der strengste Lehrer, den ich je hatte.
Um die Schule zu schwänzen, schützte ich nicht selten Übelkeit oder Bauchschmerzen vor. Manchmal glaubte mir meine Mama nicht, also musste ich mir etwas Besseres einfallen lassen. Ich saß dann beispielsweise eine Weile nah am Ofen oder berührte mit meiner Stirn den warmen Heizkörper, um Fieber vorzutäuschen. Irgendwann konnte Mama meine »Erkrankungen« nicht mehr ernst nehmen und dann hatten wir sogar ab und zu Streit. Um mich um jeden Preis zur Schule zu zwingen, rief sie Dima an. Das war mir dann wirklich unangenehm. Ich wollte nicht, dass mein Vater erfuhr, dass ich keinen Bock auf Schule hatte. Doch nach einem kurzen Gespräch mit ihm, nachdem ich ihm versichert hatte, dass wir heute eh nur Sportunterricht hätten und alle anderen Fächer ausfielen, verstand er mich und beruhigte meine wütende Mutter. Manchmal überzeugte er mich aber doch, zur Schule zu gehen.
Einmal bekam ich auf dem Weg zur Schule tatsächlich Grund, sie zu schwänzen: Ein unerwarteter lauter Knall rechts von mir erschreckte mich, sodass ich meinen Kopf ruckartig herumriss. Jede weitere Bewegung verursachte höllische Schmerzen, sodass ich mit seltsam verdrehtem Kopf nach Hause gehen musste. An der Eingangstür angekommen, klingelte ich. Mama öffnete mir die Tür mit bereits verdrehten Augen.
»Was hast du denn schon wieder?«
»Ich kann meinen Kopf nicht drehen, das tut weh«, antwortete ich jammernd. Sie ließ mich rein. Gut. Diesmal glaubte sie mir zum Glück.
Erst nach einigen Tagen war ich in der Lage, den Kopf zurückzudrehen. Meine Güte, war ich froh darüber, denn mit einem verdrehten Kopf konnte ich nicht richtig zocken, was ich ja normalerweise tat, wenn ich es schaffte, nicht zur Schule zu gehen.
Robert, mein erster deutscher Schulfreund
Nach einiger Zeit freundete ich mich mit Robert aus meiner Klasse an. Er war ein typischer Bad Boy, der gerne seine Muskeln zeigte und sich über andere Schüler lustig machte, wenn sie anders oder schwächer waren. Ich war allerdings auch alles andere als der Durchschnittstyp in der Schule. Ein Gaming-Nerd zu Hause und eher ein Außenseiter in der Schule. Trotz meiner Schwächen hatte ich anscheinend etwas an mir, das mich ebenfalls zu einem Bad Boy machte. Vielleicht, weil ich aus Russland kam und Robert unzählige russische Schimpfwörter, wie »Súka Blyat« oder »Idi Ná Huj« beibrachte, mit denen er dann andere Schüler und Lehrer beleidigte, ohne dass sie ihn verstanden.Ich verstand mich gut mit Robert, obwohl wir keine gemeinsamen Interessen außer dem Nicht-Aufpassen im Unterricht und Masturbieren hatten. Es gefiel mir zum Beispiel, wie er mich Sascha nannte. Das klang so vertraut und erinnerte mich an meine Freunde aus Russland. Die anderen Schüler nannten mich Alexander, was auch okay war, aber in meinen Ohren eher distanziert wirkte. Und die, die mich Alex nannten, mit denen hatte ich auf freundschaftlicher Ebene gar nichts zu tun. Mit Alex fühlte ich mich am wenigsten angesprochen, wahrscheinlich, weil ich Alex eher mit Alexey assoziierte.
Robert und ich wurden oft aus dem Unterricht geschmissen. Wir durchblätterten während der Stunden das zum Fach dazugehörige Buch, um nach komischen Leuten zu suchen und dann zu sagen »Guck mal, das bist du!« Das Ziel war es, den anderen zum Lachen zu bringen. Alles war witziger, wenn das Lachen verboten war. Nachdem einer von uns zu lachen anfing und auch der andere sich das Lachen nicht verkneifen konnte, wurden wir vor die Tür gesetzt, mit einem lauten...
Eines Tages machte meine Klasse einen Schulausflug nach Hannover zu einer Messe. Wir hatten mit Herrn Wiezer vereinbart, dass wir uns alle am Ende der Veranstaltung vor dem Messegelände treffen würden. Robert und ich hatten das natürlich vergessen als wir uns auf der Toilette aufhielten.
Robert war in einer Kabine, und ich war in der Kabine nebenan. Irgendjemand kam in die Toilette und pinkelte ins Pissoir. Es war still, und man konnte nur das Geräusch hören, wie der Pissstrahl auf die Emaille des Pissoirs traf.
Plötzlich hörte ich ein schnelles PLUP PLUP PLUP aus Roberts Kabine, als würde er Steine ins Wasser schmeißen. Wieder Stille. Ich kannte ihn sehr gut und wusste, dass er seine Toilettenminen gezielt mit Absicht abwarf. Ich versuchte krampfhaft, mein Lachen zu unterdrücken und presste meine Lippen zusammen. Nach weiteren Abwürfen folgte ein längerer Kettensägengeräusch, das meine Lachdämme zum Brechen brachte. Ich öffnete meinen Mund und lachte wie ein ächzender Hund. Offensichtlich hörte mich Robert und legte mit weiteren Tönen nach: BSSSSSS BRRR PFFFFFFFFFF. Es war eine wahre Klaviatur der Körpergeräusche, die er zum Besten gab. Diese Komposition brachte das Fass zum Überlaufen. Ich fing an laut zu lachen.
Plötzlich jedoch wurde mein Lachen übertönt, als ein lauter, aber sehr kurzer Furz, ähnlich dem Knall einer Magnum-Patrone, aus der Richtung der Pissoire ertönte. Gefolgt von einem lauten Zuklappen der Tür.
»Was machst du da?«
Ich schaute mich um und sah, wie Robert mit seinem grinsenden Gesicht, kopfüber, durch den Spalt unter der Kabinenwand schaute. Schnell kam ich aus meiner Hocke vom Klodeckel runter und setzte mich wie ein normaler Mensch hin, in der Hoffnung, dass Robert meine Lieblingssitzposition auf der Toilette, die mir etwas peinlich war, nicht gesehen hatte.
»Der Typ hat einfach gefurzt und ist abgehauen«, prustete Robert und lachte dabei so herzhaft, dass ich in einen Lachflash versank und mir beinahe die Tränen kamen. Ich konnte das obere Teil von Roberts Gesicht sehen, das inzwischen so rot war wie eine reife Tomate.
Als Roberts Gesicht unter der Kabine verschwunden war, verstummte unser Lachen langsam. Plötzlich wurde die Stille durch Roberts panische Worte unterbrochen: »Scheiße, wir sind zu spät!«
Schnell zog ich meine Jeans hoch und rannte Robert hinterher, der schon wie ein geölter Blitz aus der Toilette verschwunden war. Ich erreichte den Treffpunkt außer Atem und sah nur Robert da stehen, mit beiden Armen an der Hüfte, nach links und rechts schauend.
»Oh Scheiße, unsere Klasse ist schon weg«, kommentierte ich, und ein leicht panisches Gefühl überkam mich.
»Was machen wir jetzt?«, fragte Robert ratlos, als ob ich eine Lösung hätte.
»Herr Wiezer hat die Fahrkarten. Hast du denn etwas Geld dabei?«
»Nein, sehe ich so aus?«, antwortete Robert grinsend. Weder Robert noch ich hatten Bargeld oder Handys, um unsere Eltern anzurufen.
»Wir müssen jemanden finden, der ein Telefon hat«, schlug Robert vor.
»Kennst du die Nummer von Herr Wiezer oder von deinen Eltern auswendig?«.
»Hmm, nein. Und du?«
»Ich auch nicht. Wir müssen wohl schwarzfahren«
»Ja, lass machen. Wo ist denn hier der Bahnhof?!«
Uns blieb nichts anderes übrig, als den Weg zurück zum Bahnhof selbst zu finden und dann schwarz zu fahren. Nach einem zweistündigen Fußmarsch, mit Hilfe freundlicher Menschen, die uns den Weg zum Bahnhof wiesen, erreichten wir ihn endlich.
»Wir müssen zum Gleis zwölf«
Der Zug stand bereits da.
»Ich habe eine Idee«, flüsterte ich, als wir vor der offenen Zugtür standen. »Wir gehen jetzt sofort zur Toilette und verstecken uns dort, wenn der Schaffner kommt.«
»Aber der Schaffner wird sehen, dass jemand auf dem Klo ist und wird bestimmt warten, bis wir rauskommen«, brachte Robert seine Bedenken vor.
Die Zugtür schloss sich wieder. Robert überlegte und schaute nach unten. Plötzlich hob er langsam seinen Kopf und starrte mich mit weit aufgerissenen Augen an.
»Was denn?«, fragte ich neugierig, da ich vermutete, dass Robert eine Lösung gefunden hatte.
»Wir schließen die Tür gar nicht ab!«
Ein Grinsen breitete sich auf meinem Gesicht aus, und ohne ein Wort zu sagen, drückte ich den Knopf an der Zugtür, um sie zu öffnen.
Wir stiegen ein und gingen direkt zur Toilette. Auf dem Weg dorthin schlossen sich bereits alle Türen, und der Zug fuhr los. An der Toilette angekommen, standen wir krampfhaft davor und hielten Ausschau nach dem Schaffner. Robert schaute in Fahrtrichtung, und ich in Gegenfahrtrichtung.
»Ihre Fahrkarten bitte!«, hörte ich aus Roberts Richtung. Schnell marschierte ich in die Toilette hinein, Robert folgte mir.
»Bitte geh zu!«, flüsterte Robert, der sich vor Angst fast in die Hose gemacht hatte. So kannte ich den harten Robert gar nicht.
»Psst«, machte ich mit meinem Finger am Mund, um ihm zu signalisieren, dass er leise sein sollte.
Die Toilettentür ging endlich automatisch zu.
»Ihre Fahrkarten bitte«, hörten wir erneut eine undeutliche Ansage, die in der Toilette gedämpft und leise klang. Der Schaffner schien in einem kurzen Gespräch verwickelt zu sein. Robert und ich lauschten gespannt und versuchten, die Position des Schaffners zu erahnen. Nach einer Weile hörten wir kein Gespräch mehr, nur noch die Geräusche des Zugs. Wir lösten uns von der Tür und konnten etwas entspannen. Doch dann geschah es. Jemand betätigte von außen den Öffnungsknopf, und die Tür öffnete sich langsam. Wie erstarrt standen wir da und starrten ängstlich auf die Tür, als würde sie ein Portal in ein Paralleluniversum öffnen.
»Nächster Halt: Harsum«, kündigte eine leise Lautsprecheransage an.
Robert ging an dem Mann vorbei, ich folgte ihm. Der Mann ging hinein und drückte auf den Knopf, um die Tür zu schließen. Während die Tür zuging, stand er immer noch da und starrte uns an. Wir starrten zurück, bis die Tür geschlossen war. Sobald der Zug anhielt, rannten wir sofort heraus.
Nun waren wir endlich am Bahnhof in Harsum.
»Ach, guck mal! Da ist Herr Wiezer«, bemerkte ich.
»Wir sind am Arsch«, antwortete Robert, und wir gingen auf unseren böse dreinblickenden, fast zwei Meter großen Klassenlehrer zu.
»Mitkommen«, forderte er uns mit seiner tiefen, wütenden Stimme auf, ihm zu seinem Van zu folgen.
Bevor Robert die Tür schließen konnte, fuhr er los. Er fuhr hektisch - sein alter Van wackelte überall, dröhnte, das Armaturenbrett vibrierte, während wir beide auf dem Rücksitz saßen. Bei jeder Unebenheit wurden Robert und ich nach oben geschleudert. Robert stieß seinen Kopf gegen das Autodach und hielt sich vor Schmerz den Kopf. Wir sahen uns an und hatten denselben Gedanken: Die Autofahrt war zum Totlachen. Aber wir mussten uns zusammenreißen, denn unser Klassenlehrer, der uns böse durch den Rückspiegel ansah, jagte uns große Angst ein. In diesem Moment war uns klar, dass wir in großer Schwierigkeit steckten.
Wegen diesem Verhalten und anderen Vorkommnissen, wie unserem Zuspätkommen oder dem Rausschmiss aus dem Unterricht, bekam ich zum ersten Mal eine Klassenkonferenz. Dazu wurde ich an einem runden Tisch von allen Lehrern verhört, während sie mich die ganze Zeit anstarrten. Es war kaum auszuhalten; ich musste losheulen. Es war mir nicht mehr erlaubt, neben Robert zu sitzen und Gruppenarbeiten mit ihm zu erledigen. Den letzten Kontakt mit Robert hatte ich am Ende der neunten Klasse während einer Klassenfahrt. Dort waren wir nämlich auf dem gleichen Zimmer.
Durch den fehlenden Kontakt zu Robert bekam ich allerdings mehr Kontakt zu anderen Mitschülern. Marcel, ein sehr fauler aber sehr guter Schüler in Mathematik, brachte mich auf das sogenannte Online-Rollenspiel namens World of Warcraft, dessen Gebühren von zwölf Euro pro Monat ich von meinem Taschengeld bezahlte. Er war ein Schurke und ich ein Paladin namens Excallibur, ein Ritter des Lichts auf der Seite der Allianz. Marcel und ich verbrachten schlaflose Nächte voller Abenteuer in der riesigen Welt von Warcraft. Ich war so vertieft in das Spiel, dass ich sogar vergaß, etwas zu essen. Gut, dass es noch meine Mutter gab, die mir Butterbrote ins Zimmer brachte.
Ich achtete weniger auf mein Aussehen. Meine fettigen Haare wurden schulterlang, weil ich schon länger nicht beim Friseur gewesen war. In der Schule war ich sehr müde, gähnte ständig, und aufpassen konnte und wollte ich überhaupt nicht; stattdessen dachte ich nur an World of Warcraft.
Später erzählte ich meinen Freunden Max, Maxim, Alexey und Thomas, den ich in der Molitoris-Schule kennengelernt hatte, von dem Spiel und sie stiegen auch ein; allerdings auf der gegnerischen Seite der Allianz, der Horde, sodass ich gezwungen war, mitzuziehen. Also erstellte ich mir einen neuen Charakter, ebenfalls einen Paladin auf der Seite der Horde, um mit meinen Freunden zusammen spielen zu können. Und so kämpften wir Seite an Seite – während wir über Skype redeten – gegen die schrägsten Kreaturen, sammelten Gegenstände, erkundeten die Welt und kämpften gegen die Allianz. Es war ein sehr fesselndes Spiel, das uns die reale Welt komplett vergessen ließ.
Trotz World of Warcraft schloss ich in der Klitoris-Schule – wie sie von den Schülern scherzhaft genannt wurde – die neunte Klasse ab und erwarb damit meinen ersten Schulabschluss in Deutschland – den Hauptschulabschluss. Der Abschluss war nur eine Nebensache, denn viel wichtiger war unser Fortschritt in World of Warcraft.
Zusammen mit Alexey, der einen Druiden spielte, brachten wir Siege für die Horde. Später wechselte ich mit meinen Freunden auf die Gegnerseite der Horde, die Allianzseite, wo wir dann endgültig blieben. Dann wurde ich zu einem Menschenmagier mit einem sehr einfallsreichen Namen »Fufaev«.
Als Max keine Lust mehr hatte, die Spielgebühren zu zahlen, verkaufte er seinen Account bei Ebay. Dann verabschiedete sich auch Thomas mit seinem Hexenmeister. Alexey war auch seltener online. Maxim und ich waren die einzigen, die noch aktiv dabei waren. Allmählich verwandelte sich das fesselnde Spiel zu einem reinen Zeitvertreib. Und so ging unsere gemeinsame Zeit in World of Warcraft zu Ende – und mit ihr begann auch unsere Freundschaft zu verblassen.
Klassenkonferenz
 Mein World of Warcraft Charakter, ein Magier mit einem futuristischen Transmog.
Mein World of Warcraft Charakter, ein Magier mit einem futuristischen Transmog.
Habe ich dich inspiriert? Ich würde mich sehr über eine kleine Spende (5-10 Euro) für meinen Lebensunterhalt freuen. Ich danke dir! ❤ Wenn du Fragen oder Feedback hast, schreib mir gern eine E-Mail an mein@gottespfad.de
Gottespfad - Über mich - Lebensstil - 📚 Bücher - ❤️ Spenden
Tagebuch: vor 1992 - 1992/98 - 1998/99 - 1999/2002 - 2002/03 - 2003/05 - 2005/07 - 2008/10 - 2011/13 - 2014 - 2015 - 2016/19 - 2019/21 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025
Mein Hostinganbieter (bis zu 80% Rabatt mit diesem Link)